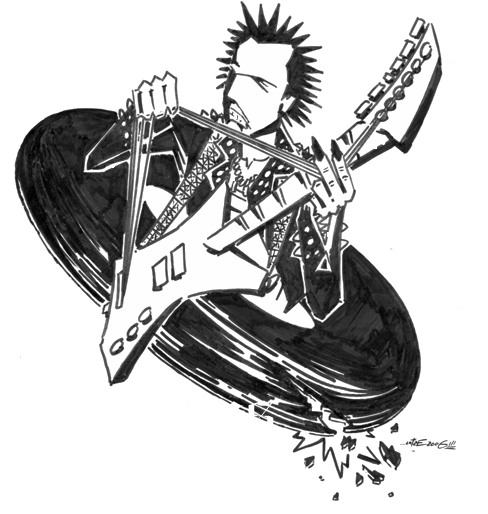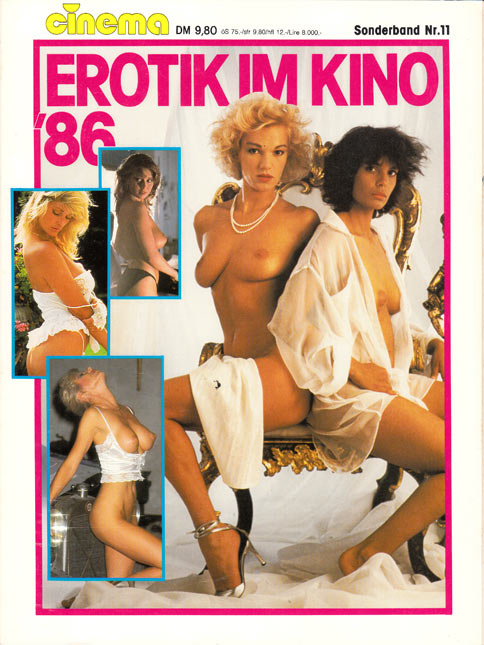In der Edition-Alfons-Reihe „Texte zur graphischen Literatur“ erschien im Jahre 2024 dieses rund 240-seitige Taschenbuch des Comic-Experten Christian Blees, der Licht ins Dunkel deutscher Grusel- und Horror-Comicpublikationen zu bringen antritt – und damit auch als Ergänzung zu Alexander Brauns zwei Jahre zuvor erschienenen „Horror im Comic“-Kompendium verstanden werden kann, das sich dem internationalen Raum widmete (und ich noch nicht gelesen habe, daher keine weiteren Vergleiche). Das Buch ist in zehn Kapitel gegliedert, die von einem Vorwort sowie je einem Inhalts-, Literatur-, Stichwort- und Abbildungsverzeichnis flankiert werden.
In der Edition-Alfons-Reihe „Texte zur graphischen Literatur“ erschien im Jahre 2024 dieses rund 240-seitige Taschenbuch des Comic-Experten Christian Blees, der Licht ins Dunkel deutscher Grusel- und Horror-Comicpublikationen zu bringen antritt – und damit auch als Ergänzung zu Alexander Brauns zwei Jahre zuvor erschienenen „Horror im Comic“-Kompendium verstanden werden kann, das sich dem internationalen Raum widmete (und ich noch nicht gelesen habe, daher keine weiteren Vergleiche). Das Buch ist in zehn Kapitel gegliedert, die von einem Vorwort sowie je einem Inhalts-, Literatur-, Stichwort- und Abbildungsverzeichnis flankiert werden.
Klar, die „Gespenster Geschichten“ aus dem Bastei-Verlag kennt jeder, aber was gab und gibt es sonst noch alles und womit fing’s eigentlich an? Blees steigt in sein Thema mit Vorläufern wie Leihbüchern und Verkaufsromanen ein, die allesamt noch erfolglos gewesen seien, mindestens einer sei gar direkt indiziert worden. Früheste deutsche Gruselcomics waren dann „Geisterschiff“-Adaptionen und einzelne Ausgaben der „Illustrierten Klassiker“. In der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre erschien eine erste kurzlebige, „Boris Karloff“ betitelte Heftreihe in US-Lizenz beim Bildschriftenverlag. Von den verspätet in den deutschen Kinos angekommenen Horrorfilmen der „Hammer Productions“ über erste Heft-, auch „Groschen“-Romane genannte Belletristik mit Gruselinhalten und Horror-Taschenbuchreihen bis zu ersten in den Geschichtenheften stattfindenden Horrorcomics, von einer ersten, ebenfalls kurzlebigen „Light-Horror“-Comicheftreihe über in Italien lizenzierten Erotikhorror für Erwachsene im Freibeuter-Verlag bis zu den ebendort erschienenen „Tomba“- und „Horror Comic“-Büchern, die jeweils von 1972 bis 1974 publiziert wurden, spannt Bees den Bogen bis zu jenem Zeitpunkt, als der Horrorcomic endlich in Deutschland Fuß zu fassen schien und mit dem bisher meine deutsche Horrorcomic-Zeitrechnung begonnen hatte: dem Erscheinen der schlicht „Horror“ betitelten Heftreihe bei BSV Williams.
Dort wurden von 1972 bis 1984 in 148 Heften Grusel- und Fantasycomics aus dem US-amerikanischen DC-Verlag veröffentlicht, die bereits unter Einfluss des US-Zensurcodes standen, aber auch Marvels Frankenstein- und Dracula-Reihe – jeweils angereichert mit Kurzgeschichten Marvels – und eine Art „Best of EC“ als Sonderband. Blees stellt die interessante These auf, dass die erfolgreichen Riesenmonster aus dem Kino auf den Zensurcode hin für die Comics adaptiert und abgewandelt, in den frühen 1960ern aufgrund sich wandelnden Leserinteresses aber durch Superheldencomics abgelöst worden seien. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber dies einmal zu analysieren wäre sicherlich interessant. Ab den 1980ern bekamen Horrorcomics starke Konkurrenz durch die Videofilmindustrie, hier belegt durch ein Zitat aus einem panischen „Spiegel“-Artikel.
Auf die bei Pabel erschienene „Vampirella“ geht Blees detailliert inklusive aller Zusammenhänge ein und zeichnet die Entstehung der US-Magazine „Creepy“ und „Eerie“ nach. Deutschland zensierte und verbot „Vampirella“ schließlich, aber Pabel kehrte kurzerhand ohne Vampirella mit der Heftreihe „Vampir-Comic“ zurück. Diese wurde 1975 bereits wieder eingestellt, weil Pabel generell keine Comics mehr verlegen, sondern sich auf seine Groschenromane konzentrieren wollte. 1981 erlebte „Vampirella“ eine Renaissance im seit jeher aufmüpfigen Volksverlag, Ende der 1990er einen Reboot bei Splitter und von 2000 bis 2004 eine Fortsetzung bei mg publishing.
Der Bastei-Verlag hingegen überflutete das Land ab 1973 mit einer Unmenge an Gruselgroschenromanen, und ein Jahr später folgten die legendären „Gespenster Geschichten“ und Konsorten. Zu letzteren gehörte „Axel F.“, eine anspruchsvollere, sich qualitativ absetzende Reihe, die aufgrund der Ignoranz des dafür zu alt gewordenen Herrn Lübbe persönlich ein trauriges Ende nahm.
Spannend auch die Gründung des Condor-Verlags, in dem 1981 neun Ausgaben des „Gänsehaut“- und von ‘81 bis ‘82 des „Grusel-Comics“-Hefts erschienen, die sich auch heute noch lohnen dürften, weil laut Blees viel älterer US-Stoff enthalten sei. Beide Heftreihen waren nur kurzlebig; im weiteren Verlauf der Dekade spielte Horror auch keine große Rolle mehr für Condor (zwei „Dracula & Co.“-Taschenbücher erschienen noch), bis man gegen Ende der ‘80er mit den großformatigen Heften „Horror“ und „Geisterhaus“ noch einmal angriff und auch ein paar wenige Taschenbücher dieser Titel veröffentlichte. Das verglichen mit der klassischen Comicheft-Größe übergroße Format lag damals im Trend, war von Condor aber bereits Anfang der ‘80er für „Grusel-Comics“ verwendet worden. Jedoch war auch „Horror“ und „Geisterhaus“ nur eine kurze Existenz vergönnt.
Darüber hinaus widmet sich Blees britischen Comics in Deutschland, beginnend mit dem Carlsen-Verlag und dem „Swamp Thing“, dessen Hintergründe ebenfalls genauestens aufgedröselt werden. In den 1980ern wehrte sich das „Swamp Thing“-Team erfolgreich gegen den Zensurcode – endlich! Ab Ende der 1990er mischte Carlsen mit einer Art TV-Comics, darunter „Buffy“, plötzlich auch auf dem Heftmarkt mit, woraufhin ein Abriss zur Geschichte der TV-Comics in den USA folgt. (Es geht in diesem Buch also mitnichten nur um Deutschland, der Titel ist tiefgestapelt.) Auf „Buffy“ folgte Anfang der 2000er-Jahre „Dylan Dog“ bei Carlsen, der dann bei Schwarzer Klecks fortgesetzt wurde und später bei Libellus farbige Neuauflagen erhielt. Auch hierzu führt Blees alles an, was man wissen muss. An Dylan Dog zeigt sich deutlich: Was im Ausland (hier: Italien) ein riesiger Erfolg ist, kann hierzulande auf Sparflamme köcheln oder gar floppen. Mir nicht bewusst gewesen ist es, dass sich mehrere Hefte umfassende Sammelbände erst in den 1980ern in den USA etablierten, in den ‘90ern daraufhin auch hier – und sich als regelrechte Verkaufsschlager entpuppten. Auf Seite 137 beschreibt Blees auch wissenswerte Veränderungen auf Verlags- und Rechteebene, die Zeichnerinnen und Zeichner nicht mehr als reine Angestellte an Verlage banden, die ihnen weitestgehend die Rechte an ihrer Kunst abknöpften. Zwei Seiten weiter erhält man sogar aufschlussreiche Einblicke in die Bezahlung.
Der 2001 gegründete Cross-Cult-Verlag übernahm „Hellboy“ und wurde ab 2006 mit „The Walking Dead“ noch erfolgreicher. Von hier aus unternimmt Blees einen Abstecher zum deutschen „Spawn“-Verleger Infinity. 2007 gründete sich Panini-Comics, wo unter anderem die „Marvel-Zombies“ erschienen. Es folgte die Gründung des neuen Splitter-Verlags mit diversen Hardcover-Horrorcomic-Ausgaben. „From Hell“ erschien bei Cross Cult, „Die Legende von Malemort“ bei Splitter, „Locke & Key“ bei Panini; mit „D“ und „American Vampire“ hielten Vampire bei Splitter und Panini Einzug und, und, und – Blees notiert genau, was bei den jeweiligen Verlagen so alles innerhalb des Genres erschien.
Kapitel 9 über Horror-Mangas beginnt mit einer Erläuterung der konzeptionellen Unterschiede zwischen Comic und Manga sowie der Geschichte der Mangas in Deutschland, der hierzulande mittlerweile erfolgreichsten Comicgattung. Im letzten Kapitel behandelt Blees das Revival der Comichefte sowie aktuelle Publikationen und ilovecomics-Nachdrucke. Um einmal zu veranschaulichen, wie Blees ins Detail geht: ilovecomics druckte 2019 und 2020 die einzigen beiden „Monster“-Hefte nach, die im Jahre 1953 in den USA erschienen waren. Bei dieser Information belässt Blees es nicht, sondern handelt die Geschichte des US-Verlags ab und zeichnet ausführlich die Lebensläufe der beteiligten Zeichner und Texter nach. So sehr er aber aufs Drumherum eingeht, so wenig erfahren wir über den Inhalt – ein kleiner Kritikpunkt. Blees schließt sein Buch mit sehr zuversichtlichen Worten, was den Horrorcomic in Deutschland betrifft.
Apropos Kritik: Der einzige mir aufgefallene Fehler ist ein Setzpatzer auf den Seiten 179 und 180. Dafür scheint mir das Literaturverzeichnis nicht ganz vollständig zu sein. Auf Seite 214 hätte ich gern etwas von Esteban Maroto gesehen, um den es dort geht, statt von Miguel Gómez Esteban – das ist etwas verwirrend. Grundsätzlich ist es aber sehr zu begrüßen, dass Blees mit vielen farbigen Bildern (Titel- und Comicseiten, Panels) arbeitet, sodass sein Buch weit von einer Bleiwüste entfernt ist. Zum Thema Zensur hätte ich mir ein separates Kapitel gewünscht, vielleicht gar inklusive Liste, und ein themenübergreifendes Interview mit einem Horrorcomic-Experten hätte ebenfalls einen Mehrwert darstellen können.
Andererseits ist Blees dieser Experte selbst. Er schuf ein Buch mit wissenschaftlicher Akkuratesse, das zahlreiche erschöpfende Hintergrundinformationen, ja, regelrechte Kurzporträts der Zeichner bietet, deren Originalzitate einflicht und mit Auszügen damaliger Kritiken arbeitet. Blees erwähnt auch gern, was zeitgenössisch jeweils parallel auf dem Horrorfilm- und Buchmarkt angesagt war, und liefert so Kontext und Zeitkolorit. Er sprach mit einigen Persönlichkeiten, unter anderem mit Condor-Gründer Biehler. Das ist hochinteressant und spannend, nicht zuletzt, weil man so nebenbei allgemein etwas über die Geschichte der Comics, nicht nur in Deutschland, erfährt. Blees‘ Querverweise, was wann wo in deutschen Veröffentlichungen publiziert wurde, ist ebenfalls bestes Comichistoriker- und Nerdfutter. „Der absolute HORROR: Die Geschichte der Gruselcomics in Deutschland“ liefert ein Geschichtsseminar der neunten Kunst, Hintergrundinformationen, belegte Zitate der Verantwortlichen und nicht zuletzt Kaufempfehlungen en masse. Ich habe mir einige Titel notiert und freue mich auf deren Lektüre.
Seltsam? Aber so steht es geschrieben …