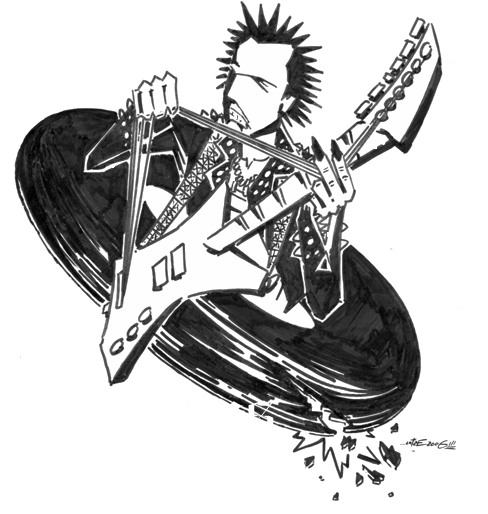Der gebürtige Passauer Günter Ohnemus ist Schriftsteller und Übersetzer englischer Literatur ins Deutsche. Im Jahre 1982 veröffentlichte er seine erste Prosa „Zähneputzen in Helsinki“ im MaroVerlag, von der mir ein Exemplar der dritte Auflage der Neuausgabe vorliegt. Frank Schäfer hatte irgendetwas darüber in „Rumba mit den Rumsäufern“ geschrieben, das mich dazu getrieben hatte, es auf meine Liste zu setzen (und schließlich auch mal zu lesen).
Der gebürtige Passauer Günter Ohnemus ist Schriftsteller und Übersetzer englischer Literatur ins Deutsche. Im Jahre 1982 veröffentlichte er seine erste Prosa „Zähneputzen in Helsinki“ im MaroVerlag, von der mir ein Exemplar der dritte Auflage der Neuausgabe vorliegt. Frank Schäfer hatte irgendetwas darüber in „Rumba mit den Rumsäufern“ geschrieben, das mich dazu getrieben hatte, es auf meine Liste zu setzen (und schließlich auch mal zu lesen).
Ohnemus erzählt in diesem rund 180-seitigen Taschenbuch um die 35 kleine, meist nur wenige Seiten, manchmal gar nur wenige Zeilen umfassende (autobiographische?) Beobachtungen, Anekdoten und Geschichten (oder „Stories“, wie es der Verlag auf den Titel druckte), die scheinbar banal beginnen, aber im Stile einer Art nüchterner Melancholie häufig nachdenklich, traurig oder verstörend (z.B. bei der Beschreibung US-amerikanischer Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg) enden. Er schreibt über „(…) Leute, die nicht so ganz mit den Sachen zurechtkommen, die ihnen zugestoßen sind, und die nicht viel mehr miteinander verbindet, als daß sie eine Zeitlang in ihrem Leben nicht wissen, was sie jetzt noch sollen.“ (aus: Katerwohnung) Selten trifft aber auch nichts davon zu; jenes lässt ihn dann schon mal wie einen etwas wirren Sonderling erscheinen.
Ein ganzes Kapitel ist dem Kino seiner Kindheit gewidmet – dort war er verdammt oft. Zuweilen widerspricht er sich: Erst will er während des Todes seines Großvaters Tipp-Kick gespielt haben, dann im Kino gewesen sein – oder aber es geht um zwei verschiedene Großväter. Auch etwas schrägen, schwarzen Humor über die Absurdität des Lebens beherrscht Ohnemus. Aus den in diesem Rahmen ungewöhnlich langen, in etliche Kurzkapitel unterteilten Beschreibungen seines Großvaters erfährt man, dass er – Günter (respektive das literarische Ich) – seine Mutter extrem früh verloren hat. Familienerinnerungen nehmen generell einen großen Raum ein und manche Geschichte enthält eine Anspielung auf eine vorausgegangene. Die Kürze der Kapitel lädt ein, stets schnell noch das nächste und wiederum dessen nächstes zu lesen, und ehe man sich versieht, ist man von Ohnemus‘ Stil eingelullt – und das Buch auch schon durch. Gelangweilt habe ich mich demnach nicht, nur hin und wieder gewundert.
Das Korrektorat hat ein paar wenige Grammatikfehler übersehen (ein statt einen u.ä.), mehr zu mosern habe ich nicht.