 Nachdem meine Liebste und ich 2018 zum bisher ersten und einzigen Mal das Headbangers Open Air im schleswig-holsteinischen Dorf mit dem Metal-Namen Brande-Hörnerkirchen besucht, uns dort ziemlich wohlgefühlt hatten und erschwerend hinzukommt, dass ich mal wieder Bock auf ein lauschigeres, kleineres Festival frei von jedweder Gigantomanie habe – und mich dann auch noch das Programm diesmal ziemlich reizte –, machen wir dem HOA unsere zweite Aufwartung. Da wir wie üblich keinen Bock auf Zelten haben, organisiere ich eine Unterkunft in Bokel, ein Dorf weiter. Mit unseren sieben Sachen machen wir uns am sehr sonnigen Donnerstag von Hamburg-Altona aus mit der Nordbahn auf den Weg und können bis Dauenhof durchfahren, wo uns ein Shuttle-Service in Empfang nimmt, der uns freundlicherweise nicht auf dem Festivalgelände, sondern am Dorf-Edeka absetzt, wo wir Frühstückszeug einkaufen und uns anschließend per pedes zur Unterkunft begeben. Diese entpuppt sich als derart idyllisch gelegen und luxuriös ausgestattet, dass sie nur zum Pennen eigentlich viel zu schade ist – und unser Gastgeber ist auch noch selbst Metal-Fan, Plattensammler und Besucher des Festivals. Die Entfernung zum Festival beträgt 3,8 km, was in etwa der Strecke zwischen Zeltplatz und Bühne auf herkömmlichen Festivals entspricht. Und da, wie wir erfahren müssen, der örtliche Taxidienst letztes Jahr pleitegemacht hat, müssen wir diese auch latschen.
Nachdem meine Liebste und ich 2018 zum bisher ersten und einzigen Mal das Headbangers Open Air im schleswig-holsteinischen Dorf mit dem Metal-Namen Brande-Hörnerkirchen besucht, uns dort ziemlich wohlgefühlt hatten und erschwerend hinzukommt, dass ich mal wieder Bock auf ein lauschigeres, kleineres Festival frei von jedweder Gigantomanie habe – und mich dann auch noch das Programm diesmal ziemlich reizte –, machen wir dem HOA unsere zweite Aufwartung. Da wir wie üblich keinen Bock auf Zelten haben, organisiere ich eine Unterkunft in Bokel, ein Dorf weiter. Mit unseren sieben Sachen machen wir uns am sehr sonnigen Donnerstag von Hamburg-Altona aus mit der Nordbahn auf den Weg und können bis Dauenhof durchfahren, wo uns ein Shuttle-Service in Empfang nimmt, der uns freundlicherweise nicht auf dem Festivalgelände, sondern am Dorf-Edeka absetzt, wo wir Frühstückszeug einkaufen und uns anschließend per pedes zur Unterkunft begeben. Diese entpuppt sich als derart idyllisch gelegen und luxuriös ausgestattet, dass sie nur zum Pennen eigentlich viel zu schade ist – und unser Gastgeber ist auch noch selbst Metal-Fan, Plattensammler und Besucher des Festivals. Die Entfernung zum Festival beträgt 3,8 km, was in etwa der Strecke zwischen Zeltplatz und Bühne auf herkömmlichen Festivals entspricht. Und da, wie wir erfahren müssen, der örtliche Taxidienst letztes Jahr pleitegemacht hat, müssen wir diese auch latschen.
Tag 1: Sodomy and Dust
Durch die eine willkommene Abwechslung zum urbanen Alltag bietende Landschaft, die Wege vorbei an Pferden, Kühen und Getreidefeldern, ist das aber alles andere als unangenehm, zumal wir’s schon von unserem vorausgegangenem Besuch gewohnt sind. Wir legen eine Punktlandung hin, indem wir um Punkt 15:00 Uhr auf dem Gelände eintreffen. Also flugs Bändchen geholt und Programmheft eingesackt, die lokale Spezialität Kirschbier bestellt (alles ohne jegliche Wartezeiten) und ab vor die Bühne, deren großes Dach sowohl vor der knallenden Sonne als auch vor etwaigem Regen schützt! Dort spielt seit ein paar Minuten der traditionelle lokale Opener, diesmal B.S.T. aus Hamburg mit deutschsprachigem Brachial-Doom – kehliger Gesang, schleppend und runterziehend. Gut, ein englischer Song ist auch darunter. Das ist sicherlich kompetent gezockt, aber halt so gar nicht mein Ding. Es haben sich indes schon reichlich Fans eingefunden, denen das gefällt – und es sei ihnen gegönnt!
- B.S.T.
Die serbische Band CLAYMOREAN existiert schon seit Mitte der ‘90er, allerdings ohne, dass ich sie auf dem Schirm gehabt hätte. (Edit: Zumindest der Song „Mystical Realm (Deorum in absentia)“ ist Teil einer meiner selbst zusammengepfriemelten Metal-Playlists, wie ich im Nachhinein feststelle.) Ihr Power Metal weist als auffälligstes Alleinstellungstellungsmerkmal Sängerin Dejana auf, die zwischen Klargesang und heiseren Screams changiert. Diese animiert das Publikum zum Mitsingen, Fistraisen und Heyen und die flotteren Songs gefallen mir ganz gut, die teils von beiden Gitarristen abwechselnd gezockten Soli ebenfalls. Der nominell letzte Song wartet mit coolen mönchschoralähnlichen Backgroundgesängen auf und anschließend ist sogar noch Zeit für ‘ne Zugabe, die Mark „The Shark“ Shelton von MANILLA ROAD gewidmet wird, der seinerzeit 2018 leider nach seinem HOA-Auftritt verstarb. Gelungener Auftritt, ich komme auf Temperatur.
- Claymorean
HIGHWAY CHILE stammen nicht etwa aus Südamerika, sondern aus Holland, brachten es zwischen 1983 und 1991 auf drei Langdreher und veröffentlichten 2008 ein Comeback-Album. Von all dem kenne ich aber nichts und der Midtempo-Hardrock klingt für unsere Ohren eher belanglos. Doch was wissen wir schon, denn die Leute finden’s super. Anscheinend wird eines der Alben in voller Länge gespielt. Die zwei, drei Uptempo-Nummern laufen mir dann auch doch ganz gut rein, vor allem der vorletzte (oder letzte?) Song entpuppt sich als Hit. Kommen auf meine Noch-mal-reinhören-Liste.
- Highway
- Chile
TAILGUNNER aus dem UK zählen zu den jungen Wilden im klassischen Metal, letztes Jahr erschien ihr Debüt-Album „Guns for Hire“. Die vier Jungs und die Gitarristin wollen’s wissen und knien sich ordentlich rein, so ist dann auf der Bühne auch gleich bischn mehr los. Als dritten Song covert man den Überhit „Beast in the Night“ von RANDY, den Angeberspot mit schrottigen Gitarrensoli hätte es für so’nen Festivalauftritt hingegen nun wirklich nicht gebraucht. Das gilt auch für Synchronklampfengepose und alberne Choreos, aber, jut, wenn’s Spaß macht… Mich überzeugt man schon eher mit den hymnischen Refrains, wie beispielsweise in „New Horizons“. Das Publikum dankt es (ähnlich wie zuvor bei CLAYMOREAN) mit „Tailgunner!“-Sprechchören und wird im Gegenzug zu Whohoho-Chören während „Revolution Scream“ animiert. Generell versucht man den Mob vor der Bühne mittels massiver Animationen weitestmöglich miteinzubeziehen. Das „Painkiller“-Cover schließlich ist sehr souverän gesungen, nur das Riff ging im Soundgewand der Band etwas unter. Das Publikum hat man im Sack und beim Abbau ertönt aus der Konserve „Hurry Up Harry“ von SHAM 69. Gute Wahl und ein durchaus beeindruckender, energetischer Gig. In die Platte höre ich doch glatt noch mal rein.
- Tail
- Gunner
Das Rabiatheitslevel wird anschließend durch die Landsmänner von GAMA BOMB (aus denen die Autokorrektur meiner Notiz-App „Gamaschen Bomb“ macht) weiter gesteigert, ebenso die Bühnenaction: Mit punkigem Thrash wird kräftig Alarm und Party gemacht, ein Monster torkelt auf die Bühne, trockenes Shouting trifft auf hohe Screams und natürlich Riffs galore. Die Ansagen werden stets kurzgehalten, bevor’s mit full speed ahead weitergeht, mit einer Ausnahme: Für die Ankündigung eines antifaschistischen Songs nimmt sich Sänger Philly etwas mehr Zeit und formt anschließend eine Wall of Death. Mit dem THE-POGUES-Cover „If I Should Fall From Grace With God” läutet man nur scheinbar so langsam das Ende ein, denn es gibt immer noch ‘nen Song, und noch einen usw… Auf Platte sind mir GAMA BOMB etwas zu gleichförmig, und so super abwechslungsreich klingen sie hier nun auch nicht gerade, aber die Show ist spitze, mitreißend und macht Bierdurst.
- Gama Bomb
Meine Vorfreude auf die belgischen EVIL INVADERS ist immens, denn obwohl das Quartett nicht gerade spiel- und tourfaul ist, liegt mein letzter Gig schon viel zu lang zurück. Das ist eine Band, die beim Blick aufs heurige Line-Up mit den Ausschlag für den Ticketerwerb gab, und erwartungsgemäß ließen die Speedster es ordentlich krachen. Die Songs vom aktuellen Album sind auch live klasse, die älteren natürlich auch – da ist’s fast ein bisschen schade, dass man mit „Witching Hour“ (VENOM) und „Violence and Force“ (EXCITER) gleich zwei Coverversionen integriert. Dafür bekomme ich aber endlich mal wieder meinen Uralt-Überfavoriten „Tortured by the Beast“ um die Ohren gehauen. Mittlerweile ist’s dunkel geworden, was die großartige Lightshow voll zur Geltung bringt, wenn sie nicht gerade von kiloweise Rauch und Nebel torpediert wird – was es natürlich umso geiler macht. Leider übertreibt man es beim Sound mit dem Hall, wodurch alles ein bisschen verwaschen klingt und Joe Anus‘ herrlich asoziales Gekreische etwas untergeht. War der eigentlich schon immer so spindeldürr? Junge, iss ma‘ wat! Zur Übertreibung neigt man auch beim Posing, insbesondere wenn Joe am Schluss seine Klampfe wie seinen Schwanz behandelt und einen, äh, Höhepunkt simuliert – „Gitarrengewichse“ etwas zu wörtlich genommen…
- Evil Invaders
Fast schon unprätentiöses Understatement ist dagegen das, was Sodom als Headliner des Abends abliefern. Nach dem „Klash of the Ruhrpott“ ist das mein zweiter SODOM-Gig innerhalb einer Woche, und tatsächlich variiert die spielfreudige aktuelle Besetzung um Tom Angelripper, Veteran Frank Blackfire und die beiden Jüngeren Toni Merkel und Yorck Segatz erneut die Setlist, die mittlerweile mehr und mehr einer Wundertüte gleicht und damit jeden SODOM-Gig unvorhersehbar und interessant macht: Mit einem meiner (so vielen…) Lieblingssongs „Christ Passion“ steigt man nach dem Instrumental „Procession to Golgatha“ ein, spielt Songs von acht bis neun verschiedenen Platten, liefert sich Frotzeleien untereinander, gräbt die uralte Demo-Kamelle „Let’s Fight in the Darkness of Hell“ (!!!) aus, weil noch die Zeit dafür ist, obwohl „Agent Orange“ schon angesagt worden war, haut „Leave me in Hell“ als VENOM-Hommage (und damit zweites VENOM-Cover des Festivaltags) raus – und gibt sich zwischen den Songs ganz entspannt, bodenständig und publikumsnah. Tom kritisiert die hohen Getränkepreise auf dem Klash und reicht immer wieder Getränke, einmal sogar eine Kippe von der Bühne herunter, nachdem er eine kurze Pause brauchte, weil er schließlich „nächstes Jahr 48“ werde (*räusper*), lobt das Ambiente dieses kleineren Festivals, auf dem er lieber spiele als vor 100.000 Leuten, und wird ein bisschen wehmütig, als er sagt, dass er die ‘80er vermisse. Wir alle, Tom, wir alle! In Sachen Lightshow und Nebel bekommt man auch hier einiges geboten, beim Sound hätte ich den Hall ein My zurückgedreht und die Snare etwas leiser, dafür Toms Gesang entsprechend lautergefahren. Aber das ist (noch nicht mal) Jammern auf hohem Niveau. „Ausgebombt“ geht nahtlos in „Bombenhagel“ über, womit der härteste Song des Festivals diesen trotz Krieg, Tod und Teufel herzerwärmenden Auftritt beschließt und aus der Konserve wie gewohnt das Steigerlied erklingt. Glück auf!
- Sodom
Am Ende des ersten Festivaltags ist es noch immer recht warm; in unseren Nasen sammelt sich der Staub, der vor allem bei GAMA BOMB und SODOM aufgewirbelt wurde. Wir trinken noch ‘nen Absacker und machen uns zu Fuß auf den Weg zur Unterkunft. Währenddessen beginnt es tatsächlich zu regnen, allerdings nicht unwetterartig, also ohne Weiteres auszuhalten – und sogar ganz angenehm. Ein bisschen erschöpft fallen wir in die Koje.
Tag 2: The Boys Are Back In Town
- Die V.I.P.-
- Lounge
Am nächsten Morgen frühstücken wir erst mal in Ruhe und erfahren währenddessen über Facebook, dass die Spanier IRON CURTAIN von einem Flugausfall betroffen sind und deshalb nicht wie ursprünglich geplant um 16:40 Uhr, sondern erst am nächsten Morgen zur Frühstückszeit um 10:45 Uhr auftreten werden! Den eigentlichen Slot übernehmen ARKHAM WITCH, die eigentlich um 12:00 Uhr den Reigen eröffnen sollten. Der Beginn verschiebt sich daher auf 13:05 Uhr. Daraufhin starten wir allerdings derart entspannt in den Tag, dass wir die nun erste Band, die polnischen HELLHAIM, leider glatt verpassen und erst zu ihren Landsleuten ROADHOG eintreffen. Diese zocken guten traditionelle Metal ohne Gekreische. Wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, kommt für einen Song der HELLHAIM-Sänger auf die Bühne und singt mit. Für „Liar“ wird zum Circle Pit aufgerufen, aber dafür ist’s noch ein bisschen zu früh. Der Song jedoch kann definitiv wat. Ein angenehmer Einstieg in den musikalischen Teil des Tages für uns. Und mit dem Œuvre der Band werde ich mich mal beschäftigen (ebenso mit dem HELLHAIM‘schen).
- Roadhog
Bühne frei für SPELL: Das mir bis dato unbekannte kanadische Quartett, das offenbar einst als Duo gegründet wurde, jagt erst mal eine alte Jazznummer oder so durch die Konserve und legt dann mit einem sehr eigenwilligen Sound, einer Art Mischung aus ‘70er-Hardrock, klassischem Metal und ‘80er-Synthie-Sounds, los. Der bassspielende Sänger hat eine sehr gewöhnungsbedürftige Fistelstimme, die zudem oft daneben liegt – klingt echt schräg. Es lohnt sich aber, nicht gleich Reißaus zu nehmen, denn nach und nach offenbaren sich einem einige wirklich schöne Melodien, an der Gitarrenarbeit gibt’s zudem nichts zu mäkeln. Eines der Bandmitglieder bedient mal den Oldschool-Synthesizer, mal die zweite Klampfe oder auch beides parallel. Ein langsamer, getragener Song ist fast schon Pop, aber in gut! Eine Gastgitarristin namens Alison Hell (ANNIHILATOR, anyone?) stößt fürs THE-DEVIL’S-BLOOD-Cover „A Waxing Moon Over Babylon” hinzu. Dabei gibt’s zunächst technische Probleme, während derer Teile des Publikums die Band mit „Spell! Spell!“-Rufen anfeuern, und in deren Anschluss man eine sehr gelungene Version des Songs mit sehr charakteristischem Gitarrensound zu hören bekommt. Beim letzten Song „Watcher of the Seas“ spielt sie dann kurzerhand auch gleich mit. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Werde mich mal in die Alben reinhören. Vor allem diesen „Popsong“ muss ich finden… [Edit: Gefunden! „Dawn Wanderer“]
- Spell
ARKHAM WITCH aus Keighley (West Yorkshire) tun mit einer komplett weiblichen Rhythmusfraktion etwas für die ansonsten etwas magere Frauenquote auf der Bühne und treten mit einem jungen Sänger an, der seine Sache formidabel macht. Der sich beim doomigen klassischen Metal und der NWOBHM bedienende Sound der Band läuft ganz gut rein, das punkige Uralt-Stück „We’re From Keighley“ (mit schönem „Fuck you, we’re from…“-Mitgrölrefrain) sorgt für Abwechslung, man covert „I Love The Lamp“ von THE LAMP OF THOTH, mit denen es Personalüberschneidungen gibt, besingt „Viking Pirates of Doom“ und den „Death by Heavy Metal“, bis man als Zugabe die punkige Anti-„Star Wars“-Nummer „Droid Fucker!“ auspackt.
- Arkham Witch
Wir bleiben in England, begeben uns aber in die Abteilung sinnloser Umbenennungen: TRÖJAN aus der NWOBHM-Spätphase hatten sich für ihr zweites (und bis dato letztes) Album in TALIÖN umbenannt, für ihr Comeback aber wieder den alten Namen angenommen. Demnächst soll tatsächlich ein brandneues Album folgen; selbstbewusst steigt man mit einem Song von diesem ins Set ein, in dessen Verlauf zwei weitere neue Nummern präsentiert werden. Die ersten Songs sind sehr speedig, das Instrumental „Speed Thrills“ verschafft Sänger Graeme Wyatt eine Verschnaufpause (für die er kurz von der Bühne verschwindet). Die hat er sich mehr als verdient, denn seinen durchdringenden hohen Gesang beherrscht er absolut perfekt und schließt man die Augen, glaubt man, es stehe ein junger Hüpfer auf der Bühne! Bis auf anscheinend den dreadgelockten Drummer sind auch seine Kollegen älteren Semesters aus der Originalbesetzung, aber gemeinsam legt man einen Mördergig hin, dessen Höhepunkt mein Favorit „Chasing the Storm“ ist, der als vorletzte Nummer gezockt wird. Respekt! Da freut man sich doch umso mehr aufs neue Material. Eine meiner positivsten Überraschungen auf diesem HOA.
- Tröjan
Bei den als RUNNING-WILD-Tributband (der mittleren Phase) gestarteten BLAZON STONE hat sich, seit ich sie zuletzt sah (nämlich exakt hier 2018), das Besetzungskarussell kräftig gedreht, von damals ist offenbar nur noch die Gitarrenfraktion um Bandgründer Ced Forsberg übriggeblieben. Damals war dessen Bruder am Gesang, nun haben sich die Schweden mit dem Finnen Matias Palm verstärkt. Seinerzeit hatte ich noch geargwöhnt, die fetten Chöre seien anscheinend aus der Konserve gekommen, was diesmal definitiv nicht mehr der Fall ist. Der erste Song klingt noch ein bisschen nach SANTIANO auf Metal, aber was die Gitarristen hier im weiteren Verlaufe auffahren, ist die pure Spielfreude, die gern in doppelte Leads mündet. Matias fehlt das Kehlige, Verrauchte, Bluesige in der Stimme, was RUNNING-WILD-Cheffe Rock’n’Rolf mitbringt; aber nicht, dass wir uns missverstehen: Ein hervorragender Metal-Sänger ist er zweifelsohne. Generell scheint mir der eine oder andere Song eher in einer etwas höheren Tonart angesiedelt zu sein als die mir bekannten alten RUNNING-WILD-Schoten. Hier und heute gibt’s viele Speed-Nummern und viel Melodie, wobei mir der bis zum Schluss zurückgehaltene „Stand Your Line“ vom Debüt am besten gefällt. Mit „Down in the Dark“ hat man sogar noch eine Zugabe parat. Seine Texte scheint Matias zumindest zeitweise vom Bühnenboden abzulesen – kein Wunder, wenn man in vier Bands gleichzeitig spielt…
- Blazon Stone
DUST BOLT aus Bayern spielen einen etwas moderneren Thrash-Sound mit zwei Klampfen, das jüngste, mittlerweile fünfte Album erschien im Februar. Ist nicht 100%ig meine Mucke, macht live aber einiges her. Als eine Saite riss (oder so), muss man etwas Zeit überbrücken, zieht ansonsten aber konsequent durch. Während eines Songs begibt sich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Sänger und Gitarrist Lenny in die Mitte eines amtlichen Circle Pits, um dort weiterzuzocken. Gegen Ende packt man reichlich Kunstnebel aus und beendet den Gig mit dem NEIL-YOUNG-Cover „Keep On Rockin In The Free World“, das mit schweren lauten Gitarren einfach geil klingt und von der Meute begeistert mitgesungen wird.
- Dust Bolt
Als ich im Vorfeld gesehen hatte, dass THIN LIZZY alias BRIAN DOWNEY’S ALIVE AND DANGEROUS auf dem HOA spielen würden, war das neben EVIL INVADERS, SODOM und PYRACANDA einer der Gründe, mir ‘ne Karte zu besorgen. Denn obwohl ich kein ausgewiesener LIZZY-Fan bin, hat mich das, was ich vom Auftritt auf dem Rock-Hard-Festival letztes Jahr noch mitbekommen hatte (fußballbedingt nur ungefähr das letzte Drittel) doch sehr beeindruckt und überzeugt. Seither glaube ich an Reinkarnation, denn unter dem Namen Matt Wilson scheint Phil Lynott zurückgekehrt zu sein, damit er zusammen mit Original-THIN-LIZZY-Drummer Brian Downey wieder auftreten und die Songs des legendären Livealbums (und ein bisschen mehr) spielen sowie singen kann. Ungelogen: Wilson sieht Lynott nicht nur verdammt ähnlich, sondern singt auch wie er, ohne sich dafür verstellen zu müssen. Die Illusion ist perfekt und die beiden Gitarristen Michal Kulbaka und Joe Merriman beherrschen den Heavy-Bluesrock-Sound der irischen Legende perfekt. Meine Liebste und ich beschließen, erst einmal genug vor der Bühne gestanden zu haben, und beziehen eine seitliche Sitzbank bei trotzdem guter Sicht. So lauschen wir den Twin-Gitarren, den pumpenden Rhythmen und der leichten irischen Melancholie in den mit warmer Stimme vorgetragenen Songs. Downey & Co. erweisen sich eines Headliners mehr als würdig, bringen nicht nur mit dem Traditional „Whiskey in the Jar“ zig heisere Kehlen zum Mitsingen und haben noch drei Zugaben im Köcher, darunter eine Coverversion des ehemaligen LIZZY-Gitarristen GARY MOORE. Auf unserer Sitzbank haben wir jedoch eine nun nicht mehr 100%ig gertenschlanke und nüchterne Piratin (darauf lassen zumindest ihr Hut und ihr Rumdurst schließen) an Bord, die ihrer Begeisterung durch exzessiven Sitztanz Ausdruck verleiht und sich für Selfies so weit zurücklehnt, dass sie uns fast auf dem Schoss liegt. Immer wieder fühlt es sich fast an, als würden wir bald kentern, letztlich schippern wir aber in sichere Fahrwässer.
- Brian Downey’s
- Alive and
- Dangerous
Nass werden wir dennoch ein bisschen, denn das Wetter ist heute unbeständiger als noch gestern. Weil wir’s am nächsten Morgen möglichst zu IRON CURTAIN schaffen wollen, machen wir uns flott auf den Weg. Zu unserem Glück steht direkt an der Straße ein aus Elmshorn bestelltes Taxi, das noch etwas Zeit hat und uns gerne zu unserer Unterkunft fährt. Das ist nicht zuletzt deshalb praktisch, weil ich dadurch meine Plattenkäufe vom Dying-Victims-Stand nicht durch die Gegend zu schleppen brauche und die guten Stücke nicht nasswerden können.
Tag 3: Vera am Mittag Abend
Anstatt wie am Vortag herumzutrödeln, lassen wir schon früh den Wecker schellen, schließlich sollen IRON CURTAIN schon um 10:45 Uhr den dritten und letzten Festivaltag eröffnen. Zum Einen haben wir Bock auf die Band, zum Anderen wollen wir ihr mit unserer Anwesenheit Dank dafür erweisen, diese irre Odyssee auf sich genommen und nicht einfach abgesagt zu haben. Nach dem stärkenden Frühstück marschieren wir im Stechschreit in Rekordgeschwindigkeit zum Gelände und verpassen lediglich die ersten Minuten. Angesichts der hübschen Bühnendeko wird auch der Grund für den verpassten Flug klar – mit solch schweren Ketten kommt niemand durch den Metalldetektor. Sehr viel Metal(l) ist auch in ihrem Sound auszumachen, der zackigen Speed mit MOTÖRHEAD-Räudigkeit kreuzt und zu derart ungewohnt früher Stunde die Frühstückseier hartkocht. Die Kulisse ist für die Uhrzeit beachtlich und Bandkopf Mike Leprosy nimmt sich die Zeit, kurz von der beschwerlichen Anreise zu berichten – mit dem Lächeln eines Metal-Gladiators (Songtitel) auf den Lippen. Ein Zwischendrintro aus dem Off sorgt für eine kurze Verschnaufpause, bevor einem weiter mit der Streitaxt der Schlaf aus den Klüsen geprügelt wird. Die Fans dankten es mit „Iron Curtain!“-Sprechchören, in die Mike mit einsteigt, aber versehentlich „Iron Maiden“ skandiert… Es wird nicht ihr einziger Auftritt auf diesem HOA bleiben, aber dazu später mehr.
- Iron
- Curtain
Nicht ganz so weit zum Festival hatten es die dänischen ‘80er-Veteranen ALIEN FORCE, die seit 2021 mit einem Comeback-Album wieder am Start sind. Im Gepäck haben sie ein paar gute Nummern, aber für meinen Geschmack auch viel etwas arg gemütliches Midtempo-Zeug. Der Sänger hat ein schön kräftiges Organ und kommt ohne Eierkneif-Screams aus, was mich positiv an manch andere dänische Band erinnert. Die letzte Nummer, der Titeltrack ihres Debüts „Hell and High Water“, wird am meisten gefeiert.
- Alien
- Force
Dann endlich PYRACANDA! Die Koblenzer, die in den Jahren 1990 und 1992 zwei Alben veröffentlichten (von denen ich das Debüt „Two Sides of a Coin“ sehr schätze), sind seit 2019 mit drei Originalmitgliedern zurück und wirken wie eine hungrige Band, der man ihr Alter kaum anmerkt. Sänger Hansi ist überaus agil und mit seinem Klargesang bestens bei Stimme. Die Klampfen liefern derbes Geschrubbe, Groove und Melodie zugleich, die tiefen Background-Shoutings besorgen schöne Kontraste und kommen verdammt gut rüber. Im Oktober erscheint ein neues Album, worauf Hansi mehrfach hinweist, und so gibt’s auch zwei neue, noch unveröffentlichte Stücke zu hören, von denen das erste (sehr gelungene!) hier seine Live-Premiere feiert. Das zweite taucht später im Set auf, heißt „Hellfire“ und wird wohl die erste Single werden. Auch PYRACANDA gönnen sich ein kurzes Intermezzo aus der Konserve. Zwischendurch stellt Hansi den neuen Gitarristen Frank vor, der hier seinen Einstand feiert, und versingt sich bei „Democratic Terror“ kurz, wofür er sich im Anschluss entschuldigt. Letzteres wäre nun wirklich nicht nötig gewesen, denn das war ein ziemlich geiler Auftritt!
- Pyracanda
Die US-Amerikaner MEGA COLOSSUS sind in der Szene derzeit irgendwie in aller Munde, was sich mir nicht so ganz erschließt, denn so richtig meins ist ihr klassischer Metal mit Epic-Schlagseite nicht. Gute Musiker sind’s zweifelsohne, doch das Songwriting kickt mich nicht so ganz. Aber was weiß ich schon, die Leute feiern die Band mit Sprechchören – und mit dem letzten Song, dem Speedster „Razor City“, entdecke ich tatsächlich einen (nach „Fortune and Glory“) weiteren Song, der mir gefällt.
- Mega Colossus
Nun wird’s wieder etwas spezieller: NOTHING SACRED aus Australien waren, wie manch andere Band hier, bereits in den ‘80ern am Start und veröffentlichen seit 2020 in veränderter Besetzung wieder neue Musik, liefen bisher aber unter meinem Radar. Unter dem vieler anderer anscheinend auch, denn vor der Bühne ist’s zunächst noch ein bisschen übersichtlich, es füllt sich dann aber. Der Sänger sieht aus wie ein Familienpapa, der sich gern die Nachbarn zum Grillen auf die Veranda seines Häuschens nahe der Outbacks einlädt, erzählt von einer 40-stündigen Anreise (Alter…), fordert die Leute auf, alle mal ‘nen Schritt näherzukommen, und changiert zwischen hohem, melodischem und klagendem Gesang in normaler Stimmlage. Die Band hat irgendwas herrlich Irres an sich, das mich schmunzeln lässt. Der Drummer liefert heftiges Speed-Drumming, das die Grundlage für den eigenwilligen Thrash mit Power-Metal-Elementen, dargeboten von zwei Gitarristen, bildet. Irgendwann zieht der Sänger endlich die Kopfsocke ab und gießt sich sogleich eine Flasche Wasser über die Rübe. Bei den Kindern im Publikum entschuldigt er sich „for the language“ (womit er anscheinend die Schimpfwörter in den Texten meint), und verschafft sich eine Verschnaufpause, indem er die Bandmitglieder vorstellt. Am Schluss spielt man „Deathwish“, die erste Single „aus dem Jahre 1471 oder so“. Sehr sympathische, klasse Liveband, deren Tonträger ich mir ebenfalls mal in Ruhe anhören werde.
- Nothing
- Sacred
NOTHING SACRED waren vermutlich mit ihren Landsleuten SILENT KNIGHT zusammen angereist – und mir bis dato ebenso unbekannt. Man existiert seit 2009, hat vier Alben und zwei EPs draußen – und seit 2020 Sänger Dan Brittain am Start. Dieser kreischt im ersten Song zur mir von PENNYWISE bekannten „Bro Hymn“-Melodie, während die Gitarren gegen den etwas zu lauten Bass ankämpfen. Vornehmlich setzt Dan seine Kopfstimme ein, growlt aber am Refrain- oder Strophenende gern die letzten Silben an. Das ist geil und etwas anstrengend zugleich; am besten gefällt mir die Band aber ehrlich gesagt, wenn mal ein bisschen in normaler Tonlage gesungen wird. Der Sound wird mit der Zeit besser, kategorisieren würde ich ihn als so was wie angedüsterten Melodic-Speed. Die mehrstimmig gesungenen Refrains kommen ziemlich cool und musikalisch ist’s ohnehin top. Der eine Gitarrist greift dem anderen während eines Solos ständig ins Griffbrett, Dan ist permanent am Headbangen und Luftgitarrespielen. Gegen Ende gelingt ein Whohoho-Mitsingspielchen gut als Interaktion mit dem Publikum. Die letzte Nummer erhält ein Intro vom Band und als auch diese um ist, klingeln mir so richtig die Ohren. Klar, dass ich mich auch durchs Œuvre dieser Band hören werde…
- Silent
- Knight
Besser vertraut bin ich mit dem Material, das jetzt kommt: Eine fette Überraschung, die zum Zeitpunkt unseres Kartenkaufs noch nicht feststand. Zum 40-jährigen Jubiläum des RUNNING-WILD-Debütalbums „Gates to Purgatory“ taten sich der damalige zweite Gitarrist (und Freund des HOA) Preacher und BLAZON STONE zusammen, um das komplette Album, erweitert um Sampler-Beiträge und EP-Stücke der damaligen Zeit, live auf die Bühne zu bringen! RUNNING-WILD-Mastermind Rock’n’Rolf hatte keinen Bock, also stellte man das kurzerhand in dieser Konstellation auf die Beine. Einer der Veranstalter erläutert die Vorgeschichte, und dann kommt auch noch der damalige Drummer Hasche hinzu. Dieser erklärt, gesundheitlich angeschlagen zu sein und sich zwischen zwei OPs zu befinden, später aber zumindest einen Song mitzuspielen. Ich war gespannt wie ein Flitzebogen und wurde nicht enttäuscht. BLAZON-STONE-Sänger Matias hat seine Stimme „heruntergestimmt“ und singt nun dunkler – und Preacher hat sichtlich Spaß und posiert, als hätte es für ihn nie eine Bühnenabstinenz gegeben. „Adrian S.O.S.“ wird dermaßen schnell runtergeholzt, dass Matias kaum hinterherkommt. RUNNING WILD waren damals noch weit von ihrem erst mit dem dritten Album etablierten Piraten-Image entfernt und so jagt hier ein satanischer Song den nächsten, süffisant kommentiert vom Sänger. Das ist umso kurioser, als Preacher nicht umsonst Preacher heißt, hat er doch tatsächlich Theologie studiert und ist evangelischer Pfarrer. Aber wie er unlängst in einem Interview sagte: Das sei ja alles allegorisch gemeint gewesen. Und das war es ja auch! „Gengis Khan“ wird um einen beeindruckenden Publikumschor ergänzt, „Walpurgis Night“, „Warchild“ und „Iron Heads“ werden zwischengeschoben, der kongeniale Stampfer „Chains and Leather“ lässt die Fäuste in die Höhe recken und wird lauthals mitgesungen – und dann ist erst mal Umbaupause angesagt: Das Schlagzeug wird von Links- auf Rechtshänder (oder umgekehrt) umgebaut, damit Hasche seinen Song trommeln kann. Währenddessen lobt Preacher BLAZON STONE und holt den Wirt der Lauschbar auf die Bühne, der sie kostenlos und unkompliziert in seinen Räumlichkeiten hat proben lassen. BLAZON STONE erzählen auch noch den einen oder andere Schwank, u.a. welches RW-Album in ihrem jeweiligen Geburtsjahr herausgekommen war… „Prisoner Of Our Time“ soll also das große Finale werden, die Fans singen den Song schon mal selbst – bis es losgeht und Hasche beweisen kann, nichts verlernt zu haben. „We are prisoners of our time, but we are still alive! Fight for freedom, fight for the right – we are Running Wild!” wird zum Singalong des Abends und auch ich brülle mich heiser. Mit diesem historischen Ereignis wurde Metal-Geschichte geschrieben! Vielen Dank allen, die das ermöglicht haben, besonderer Dank an BLAZON STONE, deren sich an späteren RUNNING WILD orientierender Sound mit diesem wesentlich simpleren Teutonen-Metal aus der Pionierzeit nicht viel zu tun hat, diese Zelebrierung mitgemacht zu haben, und rasche Genesung dem guten alten Hasche!
- Gates to
- Purgatory
- 40th Anniversary
- Show
Nun ist der Veranstalter leider gezwungen, eine traurige Nachricht zu überbringen: Die MAGNUM-Coverband KINGDOM OF MADNESS um den ehemaligen MAGNUM-Keyboarder Mark Stanway und anscheinend weitere Ex-Mitglieder (und benannt nach dem Debütalbum) muss leider passen: Der Pilot ihres Fliegers von Manchester nach Amsterdam fiel krankheitsbedingt aus, wodurch die Band ihren Anschlussflug nach Hamburg verpasste und somit keine Chance mehr besteht, es rechtzeitig zum HOA zu schaffen. Zumindest eines der Bandmitglieder ist laut Veranstalter anwesend und sitzt weinend backstage. Ich bin beileibe kein großer Fan der britischen Pomprocker, traurig stimmt mich das aber doch, denn auf dem Programm stand eine Art Best-of der Zeit von 1978 bis 1994 – und auch für meine Ohren haben MAGNUM einige echte Hits komponiert, die ich gern einmal live gehört hätte. Insbesondere hat es mir das „Wings of Heaven“-Album angetan. Mit MAGNUM-Bandkopf Tony Clarkins Tod dieses Jahr hat sich das Kapitel MAGNUM ja zudem bedauerlicherweise für immer geschlossen. Dafür steht jetzt mein Plan, KINGDOM OF MADNESS auf ihrem nächsten Hamburg-Besuch beizuwohnen.

She’s got the look
Seitens der Veranstalter wurde improvisiert: MEGA COLOSSUS und IRON CURTAIN treten nacheinander noch einmal auf. Gut, MEGA COLOSSUS spielen halt noch mal eine Handvoll Songs, während wir uns die Zeit mit Biertrinken und Sabbeln vertreiben. Aber dann: IRON CURTAIN zum Zweiten, nun zu einer wesentlich Günni-kompatibleren Uhrzeit! Also ab vor die Bühne. IRON CURTAIN sind laut Mike etwas angetrunken, er klingt auch deutlich heiserer als am Morgen und dadurch noch dreckiger und stärker nach Lemmy. Auf der (diesmal undekorierten) Bühne herrscht zunächst helle Aufregung seitens der Techniker, anscheinend stimmt irgendetwas mit den Monitoren nicht. Die Band lässt sich davon nicht irritieren und klopft noch mal ordentlich aufs Mett, spielt vier oder fünf Songs, darunter die spanischsprachige Pretiose „Brigadas Satanicas“, und haut sogar noch ‘ne Zugabe raus. Anschließend lässt man sich zurecht feiern. Danke, Jungs!
- Iron Curtain
Einen hat das HOA noch: ARMORED SAINT als finaler Headliner des heurigen Festivals. Die US-Metal-Institution aus L.A. um Frontmann John Bush und Basser Joey Vera erfreut sich hierzulande seit jeher großer Beliebtheit, was sich mir nie so ganz erschloss. Ich mag den Signature-Song „March of the Saint“, aber das war’s dann eigentlich auch schon. Aber wenn wir schon mal hier sind, ziehen wir uns natürlich auch den gepanzerten Heiligen noch rein. Und das ist eine gute Entscheidung, denn nun kommen wirklich alle zusammen und stehen eng zusammengepfercht vor der Bühne, auf der SAINT eine absolut hochkarätige Show abreißen. Bush ist ein grandioser Sänger, den ich mir mit dieser Leistung auch gut und gerne seinerzeit als Dickinson-Nachfolger bei IRON MAIDEN hätte vorstellen können (statt Belladonna bei ANTHRAX abzulösen), zumal er in einen Jungbrunnen gefallen zu sein scheint, derart drahtig und topfit wirkt er, während er einige Kilometer auf der Bühne zurücklegt, ohne dass der Atem schwer würde. Die Band ist bestens aufeinander abgestimmt und eingespielt, da sitzen jeder Ton und jede Geste und Grimasse punktgenau. Vera am Mittag Bass geht ab und mit, als sei er selbst der größte Fan seiner Band, und Drummer Gonzo sieht mit seinem ulkigen Hut am Schluss aus wie ein Zauberer. Ich habe wirklich selten eine so tighte Band gesehen – dafür meinen Respekt! Eine tolle Show, wenn, ja wenn… man etwas anderes als diesen Halbgroove-Metal und dafür mehr Songs vom „March of the Saints“-Kaliber spielen würde. Musikalisch werde ich mit ARMORED SAINT wohl nicht mehr warm, ein unterhaltsamer Festival-Abschluss ist‘s dennoch. Bush bittet die Menge noch, nicht mehr betrunken nach Hause zu fahren, und draußen hat es angefangen zu regnen, was wir unter dem Dach vor der Bühne (beste Festivalerfindung ever) immer dann bemerken, wenn wir unsere letzten Bar-Moneten fürs Dithmarscher verprassen. Bei dieser Gelegenheit eines noch zum P.A.-Sound: Ich hatte es bei SODOM angemerkt, aber auch bei anderen Bands habe ich‘s zuweilen so empfunden und bei ARMORED SAINTS, wo wir wirklich mittig vor der Bühne stehen, fällt es uns besonders stark auf: Klar, die Snare muss knallen, darf aber den Gesang nicht übertönen! Das erhöht nicht etwa den Druck, sondern nimmt im Gegenteil etwas Wumms aus der Darbietung.
- Armored Saint
Ansonsten bin ich aber weitestgehend glücklich mit dem Festival. Es war ein echter Kurzurlaub und nicht nur eine willkommene Abwechslung zum Alltag, sondern auch zu meinen sonstigen Konzertaktivitäten. Ab und zu kann ich es sehr genießen, mich einfach mal vor eine Bühne zu stellen und einer mir mehr oder weniger unbekannten Band nach der anderen interessiert zu lauschen, um meine Favoriten schließlich zu feiern. Und da man sich in einem Funkloch befindet, geht vom Smartphone eine herrliche Ruhe aus, während es auf der Bühne kracht und scheppert – oder auch einfach nur wohlklingt. Bis auf die ein, zwei Ach-so-edgy-Typen mit BURZUM-Aufnähern war das Publikum nicht unangenehm. Die kostenlose Trinkwasserabgabe verhinderte allzu schlimmen Suff, Kater und Dehydration, und gesoffen dürfte trotzdem genug worden sein – nur einer von mehreren Punkten, von denen sich andere Festivals ‘ne Scheibe abschneiden können. Auch außerhalb des Bühnenbereichs gab’s sonnengeschützte Sitzmöglichkeiten. 3,- EUR für 0,3 Liter lokales Bier sind kein Schnäppchen, aber in Ordnung. Die Preise der Essensstände für Lagosch, Ofenbrot, Baumstriezel etc. erscheinen mir Festival-typisch etwas zu hoch, aber dafür sind die Dinger sättigend. Die Preise am von der HOA-Crew selbstbetriebenen Bratwoscht- und Pommes-Stand wiederum sind glaube ich heutzutage auch außerhalb von Festivals normal. 2018 gab’s noch einen von einer rührigen älteren Dame betriebenen Fischbrötchen-Stand, den wir gern frequentierten. Nun gibt’s dort irgend’nen Fischersfritz, der preislich den Vogel in negativer Hinsicht abschießt: Fischbrötchen 7,- EUR! Und zwar nicht nur die vergoldete Kaviarvariante, sondern auch das ganz normale Bismarckbrötchen, für das ich sogar im Amphitheater „nur“ 4 Öcken gelatzt habe. Nee, Alter – dat friss ma‘ schön selbst. Alles in allem ist die häufig kolportierte besondere Atmosphäre des Festivals kein Märchen, sondern gelebte und geförderte Realität.
Zurück zum letzten Festivalabend: Nach ARMORED SAINT warten wir ab, ob der Regen sich verziehen würde, was natürlich am besten am Bierstand geht. Ist leider nicht so, also packen wir unsere Ponchos aus (was ich zuletzt 2016 getan hatte, aber der fisselige Müllsack mit Aussparungen für die Extremitäten ist noch immer tadellos in Ordnung) und latschen ein letztes Mal zu unserer Unterkunft. Alles kein Problem, zu einer kleinen Herausforderung wird nur der noch mal deutlich längere Weg am nächsten Vormittag zum Bahnhof Dauenhof bei sengender Sonne, mit vollem Gepäck (u.a. den neuen Platten – es heißt nicht umsonst Heavy Metal) und nun doch so langsam dem Festival in den Knochen. Dafür erwartet uns am Bahnhof eine Rundum-sorglos-Gewerbeansiedlung mit Tanke, Imbiss und Eisdiele. Die Nordbahn ist pünktlich; bischn durchgedengelt, dafür mit ausdefinierten Wanderwaden treffen wir wohlbehalten wieder zu Hause ein. Danke ans HOA-Team für dieses geile Festival!
- Hail the goat!
Teile des nächstjährigen Programm stehen übrigens schon fest, regelmäßig aktualisierte Infos gibt’s auf www.headbangers-open-air.com.
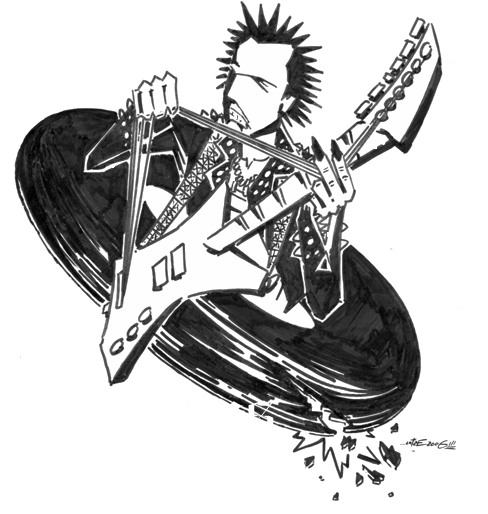


























































































































































 Liebes Konzerttagebuch,
Liebes Konzerttagebuch,


































 Der Cinema-Verlag machte mit seinen fragwürdigen „Sex im Kino“-Jahrbüchern noch eine ganze Weile weiter. Nach den Bänden über die Jahre
Der Cinema-Verlag machte mit seinen fragwürdigen „Sex im Kino“-Jahrbüchern noch eine ganze Weile weiter. Nach den Bänden über die Jahre  Die Hamburger THRASHING PUMPGUNS luden zum Record-Release-Gig ihres nach „The Lord is Back“ aus dem Jahre 2014 (echt schon zehn Jahre her?!) zweiten Albums in die Lobusch. Das konnte natürlich nur gut werden. Als Vorband hatte Shouter Rolf die seit letztem Jahr existierenden
Die Hamburger THRASHING PUMPGUNS luden zum Record-Release-Gig ihres nach „The Lord is Back“ aus dem Jahre 2014 (echt schon zehn Jahre her?!) zweiten Albums in die Lobusch. Das konnte natürlich nur gut werden. Als Vorband hatte Shouter Rolf die seit letztem Jahr existierenden 



















 Es musste ja so kommen: Nachdem „Mad“-Stamm- und Kultzeichner Don Martin bereits die Taschenbuchreihe hatte eröffnen dürfen, schnappte er über, als man ihm sagte, dass auch die Nummer 4 wieder ihm ganz allein gewidmet sein würde. Im US-amerikanischen Original erschien diese im Jahre 1974, ein Jahr später stand die deutsche Fassung in den Regalen der Hochliteratur. 160 unnummerierte Schwarzweiß-Seiten strapazieren das Zwerchfell, für die Dick de Bartolo Don Martin bei den Texten unterstützte.
Es musste ja so kommen: Nachdem „Mad“-Stamm- und Kultzeichner Don Martin bereits die Taschenbuchreihe hatte eröffnen dürfen, schnappte er über, als man ihm sagte, dass auch die Nummer 4 wieder ihm ganz allein gewidmet sein würde. Im US-amerikanischen Original erschien diese im Jahre 1974, ein Jahr später stand die deutsche Fassung in den Regalen der Hochliteratur. 160 unnummerierte Schwarzweiß-Seiten strapazieren das Zwerchfell, für die Dick de Bartolo Don Martin bei den Texten unterstützte. Die von Bitzcore-Juergen organisierten St.-Pauli-Punk-Festivals – eintägige Indoor-Festivals mit jeweils vier bis fünf lokalen Bands – gingen in die fünfte Runde und nachdem wir vor ‘nem guten halben Jahr bereits bei der
Die von Bitzcore-Juergen organisierten St.-Pauli-Punk-Festivals – eintägige Indoor-Festivals mit jeweils vier bis fünf lokalen Bands – gingen in die fünfte Runde und nachdem wir vor ‘nem guten halben Jahr bereits bei der 



























 Alles in allem war’s ‘ne geile Party bei durch die Bank weg gutem, wuchtigem Sound (Danke, Andy!), wenngleich parallel das Wohlwill-/Brigittenstraßenfest mit zwei Open-Air-Gratis-Punkrock-Bühnen gleich um die Ecke stattfand. Dafür hatte sich dann doch eine ansehnliche Anzahl Besucherinnen und Besucher ins Indra verirrt. Juergen führt dort diese Festivals in schöner Regelmäßigkeit vierteljährlich durch und ich kann, auch unabhängig von etwaigen Straßenfesten oder „Konkurrenz“veranstaltungen, nur hoffen, dass sich das für alle auch wirklich lohnt. Uns als Bands kann’s egal sein, wir dürften alle unseren Spaß gehabt haben! Nur scheint mir das Indra nach wie vor etwas überdimensioniert für diese Festivals, solange kein zugkräftiger, „großer“ Name dabei ist. Läden wie die Lobusch oder die Gängeviertel-Druckerei hingegen wären wahrscheinlich voll gewesen. Und die eine oder andere Werbemaßnahme (Flyer, Plakate, Fratzenbuch-Event) etwas früher anzuberaumen, hätte sicherlich nicht geschadet 😉 Wie auch immer, das Konzept hinter diesen Lokalfestivals ist ‘ne feine, unterstützenswerte Sache.
Alles in allem war’s ‘ne geile Party bei durch die Bank weg gutem, wuchtigem Sound (Danke, Andy!), wenngleich parallel das Wohlwill-/Brigittenstraßenfest mit zwei Open-Air-Gratis-Punkrock-Bühnen gleich um die Ecke stattfand. Dafür hatte sich dann doch eine ansehnliche Anzahl Besucherinnen und Besucher ins Indra verirrt. Juergen führt dort diese Festivals in schöner Regelmäßigkeit vierteljährlich durch und ich kann, auch unabhängig von etwaigen Straßenfesten oder „Konkurrenz“veranstaltungen, nur hoffen, dass sich das für alle auch wirklich lohnt. Uns als Bands kann’s egal sein, wir dürften alle unseren Spaß gehabt haben! Nur scheint mir das Indra nach wie vor etwas überdimensioniert für diese Festivals, solange kein zugkräftiger, „großer“ Name dabei ist. Läden wie die Lobusch oder die Gängeviertel-Druckerei hingegen wären wahrscheinlich voll gewesen. Und die eine oder andere Werbemaßnahme (Flyer, Plakate, Fratzenbuch-Event) etwas früher anzuberaumen, hätte sicherlich nicht geschadet 😉 Wie auch immer, das Konzept hinter diesen Lokalfestivals ist ‘ne feine, unterstützenswerte Sache.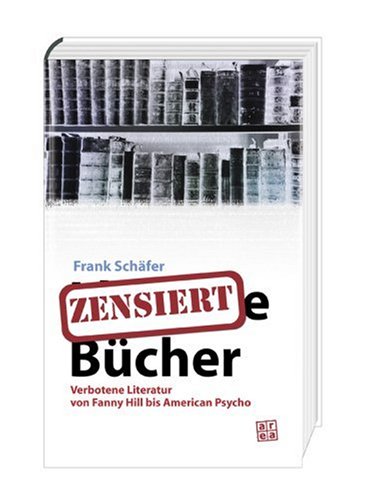 Zu meinen favorisierten zeitgenössischen deutschen Autoren sowohl im Sachbuchbereich als auch in der Belletristik zählt der Braunschweiger Literatur- und Musikexperte Frank Schäfer, ohne dessen im Jahre 2007 im Erftstädter Area-Verlag erschienener, rund 400-seitiger Abhandlung über von der Zensur betroffene Bücher ich nicht mehr auszukommen beschloss und sie mir neben
Zu meinen favorisierten zeitgenössischen deutschen Autoren sowohl im Sachbuchbereich als auch in der Belletristik zählt der Braunschweiger Literatur- und Musikexperte Frank Schäfer, ohne dessen im Jahre 2007 im Erftstädter Area-Verlag erschienener, rund 400-seitiger Abhandlung über von der Zensur betroffene Bücher ich nicht mehr auszukommen beschloss und sie mir neben 

















