 Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, zu denen die DDR kaum Thema im Schulunterricht war. U.a. um dies zu ändern haben Bundesstiftungen wie diejenige „zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ eine Reihe von Comics gefördert, die sich möglichst sachlich zumindest mit einzelnen Aspekten der DDR-Geschichte auseinandersetzen und sich effektiv als Unterrichtmaterialien einsetzen lassen sollen. Die Comicform soll dabei helfen, Berührungsängste abzubauen, niedrigschwellig jungen Lesern den Zugang zu ermöglichen und diese für die Thematik zu interessieren. Eines dieser Werke ist der rund 100-seitige broschierte Band „Grenzfall“, der im März 2011 im Avant-Verlag erschienen ist. Die Autoren und Zeichner Thomas Henseler und Susanne Buddenberg widmen sich hier der zu DDR-Zeiten oppositionellen Untergrundzeitung gleichen Namens, die es ab 1986 auf 17 in Ostberlin von der „Initiative Frieden und Menschenrechte“ produzierte Ausgaben brachte. Mitherausgeber war Peter Grimm, der an diesem Buch mitgearbeitet hat und aus dessen Sicht die Ereignisse geschildert werden. Dabei wurden „aus dramaturgischen Gründen […] Abläufe und Personengruppen zusammengefasst“, heißt es im Vorfeld.
Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, zu denen die DDR kaum Thema im Schulunterricht war. U.a. um dies zu ändern haben Bundesstiftungen wie diejenige „zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ eine Reihe von Comics gefördert, die sich möglichst sachlich zumindest mit einzelnen Aspekten der DDR-Geschichte auseinandersetzen und sich effektiv als Unterrichtmaterialien einsetzen lassen sollen. Die Comicform soll dabei helfen, Berührungsängste abzubauen, niedrigschwellig jungen Lesern den Zugang zu ermöglichen und diese für die Thematik zu interessieren. Eines dieser Werke ist der rund 100-seitige broschierte Band „Grenzfall“, der im März 2011 im Avant-Verlag erschienen ist. Die Autoren und Zeichner Thomas Henseler und Susanne Buddenberg widmen sich hier der zu DDR-Zeiten oppositionellen Untergrundzeitung gleichen Namens, die es ab 1986 auf 17 in Ostberlin von der „Initiative Frieden und Menschenrechte“ produzierte Ausgaben brachte. Mitherausgeber war Peter Grimm, der an diesem Buch mitgearbeitet hat und aus dessen Sicht die Ereignisse geschildert werden. Dabei wurden „aus dramaturgischen Gründen […] Abläufe und Personengruppen zusammengefasst“, heißt es im Vorfeld.
Nach einem kurzen Prolog gibt sich der Peter Grimm des Jahres 2011 als autodiegetischer Erzähler zu erkennen, der seine persönlichen Erinnerungen schildert. Von da an werden die narrativierenden Blocktexte in Vergangenheitsform formuliert, was den Eindruck subjektiver Erinnerungsschilderungen Grimms erzeugt. Der Comic steigt im Jahre 1982 ein und zeigt, wie der mit dem System unzufriedene Peter Grimm auf die oppositionelle Familie Havemann stößt und bald ins Visier der Staatssicherheit gerät, woraufhin er vom Abitur ausgeschlossen wird und schließlich zusammen mit anderen Oppositionellen im Schutz der Kirche die Zeitung „Grenzfall“ herausbringt. Minutiös wird die gefährliche, konspirative Vorgehensweise nachgezeichnet, bis in der Nacht vom 24. auf den 25. November die Falle der Stasi, der es gelungen war, einen Spitzel einzuschleusen, zuschnappte. Durch Kontakte zu BRD-Journalisten und die daraus resultierende Berichterstattung in bundesdeutschen Medien verzeichnete die Zeitung jedoch einen Popularitätsschub und zahlreiche Solidaritätsbekundungen führten zur baldigen Freilassung der inhaftierten Untergrund-Journalisten. Die Stasi hatte damit einen Pyrrhussieg errungen; die Aktion galt als wichtiger Mosaikstein auf dem Weg zur friedlichen Revolution, aus der schließlich 1989 die Wende hervorging.
All dies wird einerseits beinahe filmisch in Form einer spannenden Geschichte aufgearbeitet, andererseits aber auch sehr nüchtern vorgegangen: Die Zeichnungen sind schwarzweiß und naturalistisch, zahlreiche Auszüge aus Stasi-Berichten und reproduzierte Originalplakate sowie teilweise 1:1 nachgezeichnete Fotografien wurden integriert und dienen als textuelle und visuelle Authentisierungsmittel. Ein bestimmte Vokabeln erläuterndes und einordnendes Glossar sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis dienen darüber hinaus als paratextuelle Authentisierungsmittel. Damit ist „Grenzfall“ ein schönes Beispiel für sehr exaktes Arbeiten nahe an der Realität und die Verwendung sowie Verarbeitung authentischer Quellen auch über Zeitzeugen hinaus, wodurch das Buch tatsächlich seinem Bildungsanspruch gerecht wird. Ähnlich wie bei „Kinderland“ handelt es sich um eine Entwicklungsgeschichte, wohingegen der streng naturalistische, farblose Zeichenstil sich bewusst dem Inhalt unterordnet, von dem er in seiner Nüchternheit nicht ablenken will. Das macht „Grenzfall“ auf der visuellen Ebene dann auch etwas dröge, das Künstlerische muss hinter dem Aufklärerischen zurückstecken.
Anders als „Kinderland“ wurde „Grenzfall“ jedoch auch als Erfolgsgeschichte konzipiert; der Comic endet mit der Freilassung der Inhaftierten und dem Verweis auf die Revolution 1989. So sehr sich anhand der Geschichte exemplarisch die Probleme der nichtvorhandenen Pressefreiheit in der DDR abbilden lassen, so sehr hadere ich dem suggerierten nachhaltigen Erfolg. Die während der Wendezeit aufgekeimten Hoffnungen auf einen neuen, gerechteren deutschen Staat gerade auch vieler DDR-Oppositioneller zerschlugen sich bald, die DDR bekam den BRD-Kapitalismus übergestülpt und wurde durch die Treuhand und ihre Nutznießer ausgeplündert. Die Folge waren Massenarbeitslosigkeit und Existenznöte, politische Versäumnisse, für die u.a. die Kosten der Wiedervereinigung mitverantwortlich gemacht wurden. Innerhalb dieses gesellschaftlichen Klimas erstarkte der Rechtsextremismus, der unschuldige Menschenleben forderte. Peter Grimms „Initiative Frieden und Menschenrechte“ ging im „Bündnis 90“ und schließlich in der Grünen Partei auf, die vom Frieden alsbald nichts mehr wissen wollte und sich willfährig am völkerrechtswidrigen Jugoslawien-Krieg beteiligte. Hatten die „Grenzfall“-Herausgeber dafür gekämpft?
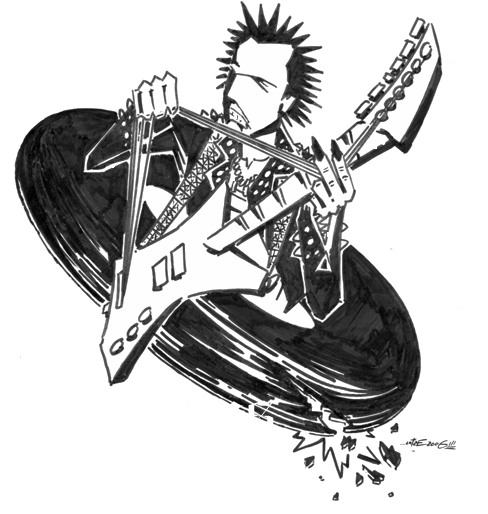
 Mawil alias Markus Witzel, Berliner Comiczeichner des Geburtsjahrgangs 1976, arbeitete sieben Jahre an seinem Wende-Comic „Kinderland“, der rund 300 Seiten umfassend 2014 im Reprodukt-Verlag erschien – im Softcover sowie in einer limitierten gebundenen Ausgabe mit festem Einband. Im Gegensatz zu Mawils vorausgegangenen Werken ist „Kinderland“ nicht unmittelbar autobiographischen Inhalts, wenngleich sich zahlreiche Parallelen zum Protagonisten Mirco Watzke allein schon aufgrund dessen Ähnlichkeit des Namens und seines Äußeren (wie ein abgedrucktes altes Passfoto Mawils zeigt) geradezu aufdrängen. Und wie Watzke erlebte auch Mawil die Maueröffnung vom Osten Berlins aus als zu pubertieren beginnender Dreikäsehoch mit.
Mawil alias Markus Witzel, Berliner Comiczeichner des Geburtsjahrgangs 1976, arbeitete sieben Jahre an seinem Wende-Comic „Kinderland“, der rund 300 Seiten umfassend 2014 im Reprodukt-Verlag erschien – im Softcover sowie in einer limitierten gebundenen Ausgabe mit festem Einband. Im Gegensatz zu Mawils vorausgegangenen Werken ist „Kinderland“ nicht unmittelbar autobiographischen Inhalts, wenngleich sich zahlreiche Parallelen zum Protagonisten Mirco Watzke allein schon aufgrund dessen Ähnlichkeit des Namens und seines Äußeren (wie ein abgedrucktes altes Passfoto Mawils zeigt) geradezu aufdrängen. Und wie Watzke erlebte auch Mawil die Maueröffnung vom Osten Berlins aus als zu pubertieren beginnender Dreikäsehoch mit.
 Als der niedersächsische Radiosender FFN noch nicht endgültig zum gesichtslosen Dudelfunk verkommen war (in den ‘80ern und frühen ‘90ern hörte ich sogar keinen Sender so gern wie diesen), leistete er sich ein allsonntägliches komödiantisches, kabarettistisches Humorprogramm, das kultgewordene Frühstyxradio, in dem spätere TV-Größen wie Oliver Kalkofe oder Oliver Welke sich ihre Sporen verdienten. Zum festen Kreis gehörte auch Dietmar Wischmeyer, auch bekannt als „Der kleine Tierfreund“ oder eben Führer des „Logbuchs einer Reise durch das Land der Bekloppten und Bescheuerten“. Der Ullstein-Verlag war es, der 1997 seine Sammlung polemischer Glossen in Buchform unters bekloppte und bescheuerte Volk brachte, 59 Stück auf rund 130 Seiten. Trocken, sarkastisch und böse metzelt er sich scharfzüngig und pointiert durch eine verspießte Gesellschaft, die zahlreiche längst als normal erachtete Absonderlichkeiten, nervige Schikanen und dummdreiste Auswüchse gebar, und knöpft sich insbesondere diejenigen vor, die diese befeuern und bedienen oder sich als ihre Nutznießer erweisen: die tumbe breite Masse ebenso wie vorsätzliche Volksverblöder, elitäre Klüngel und privilegierte Minderheiten. Oder genauer: Anwohner, Karnevalfeiernde, Kinder, Beamte, Gaffer, Lindenstraße-Glotzer, „Funsportler“, Rentner, Kellner, Jäger, Bauarbeiter, … Dabei geht er ohne Rücksicht auf Verluste oder Kollateralschäden vor und fächert seine beobachtete Alltagserfahrungen suggerierenden „Logbuch-Einträge“ derart breit, dass beinahe alles und jeder sein Fett wegbekommt. Wischmeyer prangert an und schärft den Blick dafür, was man uns antut, was die Menschen sich selbst antun und wie diejenigen, die da nicht mitmachen wollen, darunter leiden müssen. Dabei findet er durchaus originelle Themen und überrascht mit seinem Blickwinkel auf diese, suhlt sich aber auch gern in Klischees, wenn er Altbekanntes und bereits zuhauf Persifliertes aufgreift. Dass bei all dem auch Phänomene ausgewählt werden, die doch eigentlich gar nicht nerven, gehört vermutlich zum Konzept, soll ich mich doch beim Lesegenuss wahrscheinlich auch selbst hin und wieder ertappt fühlen. Wischmeyers Freude am Umgang mit und Formen von Sprache ist allgegenwärtig, selten wurden Hass und Verachtung derart geschliffen formuliert, ohne auf Reiz- und Schimpfwörter zu verzichten – manch Formulierung wirkt indes dennoch etwas umständlich erzwungen und sein Stil droht sich etwas abzunutzen, liest man zu viele Kapitel unmittelbar nacheinander. Um sicherzugehen, auch wirklich und überall anzuecken, pfeift er zudem auf jegliche politische Korrektheit. So sind Schwarze für ihn recht penetrant nach wie vor Neger und widmet sich konsequenterweise auch ein Kapitel der „Political Correctness“, für die, da muss ich ihm widersprechen es eben doch einen deutschen Begriff gibt – s.o. Als besonders bemerkenswert erachte ich jedoch dessen Inhalt, wenn er sich sprachliche Neuschöpfungen und erzwungene Modifikationen verknöpft und ganz richtig feststellt: „In Lübeck schon brannte das Asylbewerberheim sicherlich genauso gut, wie es das Asylantenheim getan hätte.“ Und widersprechen kann ihm auch niemand, der die gesellschaftliche und politische Entwicklung der letzten Jahre mitbekommen hat, wenn er jenes Kapitel mit dem Ratschlag schließt: „Drum seid lustig und seid froh, ihr Hottentotten, Kaffern und Kanaken, und gebt Obacht, wenn sie euch die neuen schönen Namen geben, denn dann geht’s euch ganz gewiß recht bald an den Kragen.“ Weder er noch ich positionieren sich damit ernsthaft gegen nicht- oder zumindest weniger diskriminierende Sprache, sondern gegen eine politische Korrektheit, die mittels Euphemismen und schönem Schein dieselbe Menschenverachtung verschleiert, die ohne sie auch für die Bekloppten und Bescheuerten leichter auszumachen wäre. Entrückte pseudophilosophische Kommentare seines Alter Egos Kassowarth von Sondermühlen sowie einige Illustrationen in Form von Fotos runden Wischmeyers erstes Logbuch ab, das mittlerweile immer wieder neu aufgelegt wurde und gleich mehrere Fortsetzungen fand. Für die Bekloppten und Bescheuerten ist das nichts. Für isoliert lebende Freunde von Sprache und Satire ist’s ein vergnügliches Beispiel für den Versuch, bissige Polemik bis an die Grenze zum Zynismus auszureizen. Für diejenigen, die ständig mit den Bekloppten und Bescheuerten konfrontiert werden, handelt es sich hingegen um irgendetwas zwischen Ventil zur Frust- und Wutabfuhr und einer witzigen, hämischen Form des Sich-verstanden-Wähnens fernab jeglicher Verständnispädagogik: Wie einer dieser laut polternden Kumpel, die man nicht ständig um sich haben möchte, mit denen man aber einfach ab und zu mal einen trinken gehen und den Trümmertango tanzen muss. In einem Punkt muss ich Wischmeyer aber korrigieren: Glasflaschen gehörten noch nie in den gelben Sack!
Als der niedersächsische Radiosender FFN noch nicht endgültig zum gesichtslosen Dudelfunk verkommen war (in den ‘80ern und frühen ‘90ern hörte ich sogar keinen Sender so gern wie diesen), leistete er sich ein allsonntägliches komödiantisches, kabarettistisches Humorprogramm, das kultgewordene Frühstyxradio, in dem spätere TV-Größen wie Oliver Kalkofe oder Oliver Welke sich ihre Sporen verdienten. Zum festen Kreis gehörte auch Dietmar Wischmeyer, auch bekannt als „Der kleine Tierfreund“ oder eben Führer des „Logbuchs einer Reise durch das Land der Bekloppten und Bescheuerten“. Der Ullstein-Verlag war es, der 1997 seine Sammlung polemischer Glossen in Buchform unters bekloppte und bescheuerte Volk brachte, 59 Stück auf rund 130 Seiten. Trocken, sarkastisch und böse metzelt er sich scharfzüngig und pointiert durch eine verspießte Gesellschaft, die zahlreiche längst als normal erachtete Absonderlichkeiten, nervige Schikanen und dummdreiste Auswüchse gebar, und knöpft sich insbesondere diejenigen vor, die diese befeuern und bedienen oder sich als ihre Nutznießer erweisen: die tumbe breite Masse ebenso wie vorsätzliche Volksverblöder, elitäre Klüngel und privilegierte Minderheiten. Oder genauer: Anwohner, Karnevalfeiernde, Kinder, Beamte, Gaffer, Lindenstraße-Glotzer, „Funsportler“, Rentner, Kellner, Jäger, Bauarbeiter, … Dabei geht er ohne Rücksicht auf Verluste oder Kollateralschäden vor und fächert seine beobachtete Alltagserfahrungen suggerierenden „Logbuch-Einträge“ derart breit, dass beinahe alles und jeder sein Fett wegbekommt. Wischmeyer prangert an und schärft den Blick dafür, was man uns antut, was die Menschen sich selbst antun und wie diejenigen, die da nicht mitmachen wollen, darunter leiden müssen. Dabei findet er durchaus originelle Themen und überrascht mit seinem Blickwinkel auf diese, suhlt sich aber auch gern in Klischees, wenn er Altbekanntes und bereits zuhauf Persifliertes aufgreift. Dass bei all dem auch Phänomene ausgewählt werden, die doch eigentlich gar nicht nerven, gehört vermutlich zum Konzept, soll ich mich doch beim Lesegenuss wahrscheinlich auch selbst hin und wieder ertappt fühlen. Wischmeyers Freude am Umgang mit und Formen von Sprache ist allgegenwärtig, selten wurden Hass und Verachtung derart geschliffen formuliert, ohne auf Reiz- und Schimpfwörter zu verzichten – manch Formulierung wirkt indes dennoch etwas umständlich erzwungen und sein Stil droht sich etwas abzunutzen, liest man zu viele Kapitel unmittelbar nacheinander. Um sicherzugehen, auch wirklich und überall anzuecken, pfeift er zudem auf jegliche politische Korrektheit. So sind Schwarze für ihn recht penetrant nach wie vor Neger und widmet sich konsequenterweise auch ein Kapitel der „Political Correctness“, für die, da muss ich ihm widersprechen es eben doch einen deutschen Begriff gibt – s.o. Als besonders bemerkenswert erachte ich jedoch dessen Inhalt, wenn er sich sprachliche Neuschöpfungen und erzwungene Modifikationen verknöpft und ganz richtig feststellt: „In Lübeck schon brannte das Asylbewerberheim sicherlich genauso gut, wie es das Asylantenheim getan hätte.“ Und widersprechen kann ihm auch niemand, der die gesellschaftliche und politische Entwicklung der letzten Jahre mitbekommen hat, wenn er jenes Kapitel mit dem Ratschlag schließt: „Drum seid lustig und seid froh, ihr Hottentotten, Kaffern und Kanaken, und gebt Obacht, wenn sie euch die neuen schönen Namen geben, denn dann geht’s euch ganz gewiß recht bald an den Kragen.“ Weder er noch ich positionieren sich damit ernsthaft gegen nicht- oder zumindest weniger diskriminierende Sprache, sondern gegen eine politische Korrektheit, die mittels Euphemismen und schönem Schein dieselbe Menschenverachtung verschleiert, die ohne sie auch für die Bekloppten und Bescheuerten leichter auszumachen wäre. Entrückte pseudophilosophische Kommentare seines Alter Egos Kassowarth von Sondermühlen sowie einige Illustrationen in Form von Fotos runden Wischmeyers erstes Logbuch ab, das mittlerweile immer wieder neu aufgelegt wurde und gleich mehrere Fortsetzungen fand. Für die Bekloppten und Bescheuerten ist das nichts. Für isoliert lebende Freunde von Sprache und Satire ist’s ein vergnügliches Beispiel für den Versuch, bissige Polemik bis an die Grenze zum Zynismus auszureizen. Für diejenigen, die ständig mit den Bekloppten und Bescheuerten konfrontiert werden, handelt es sich hingegen um irgendetwas zwischen Ventil zur Frust- und Wutabfuhr und einer witzigen, hämischen Form des Sich-verstanden-Wähnens fernab jeglicher Verständnispädagogik: Wie einer dieser laut polternden Kumpel, die man nicht ständig um sich haben möchte, mit denen man aber einfach ab und zu mal einen trinken gehen und den Trümmertango tanzen muss. In einem Punkt muss ich Wischmeyer aber korrigieren: Glasflaschen gehörten noch nie in den gelben Sack! „Woran erinnert sich eine Generation, die fast genauso lange in einem geteilten Land gelebt hat wie in einem wiedervereinten?“, fragt der Einband dieser Sammlung der seit 2006 auf den Sonntagsseiten des Berliner Tagesspiegels erschienenen Comicstrip-Reihe des deutschen Zeichners Felix Görmann alias Flix, die 2009 im Carlsen-Verlag erschienen ist und deren dritte erweiterte Auflage, die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Öffnung der Berliner Mauer veröffentlicht wurde, ich mir gekauft habe. Sie umfasst im Hardcover 34 inkl. jeweiligem Titelblatt je vierseitige, meist aus zwölf Panels bestehende „Erinnerungen an hier und drüben“, die auf Interviews basieren, die Flix mit Freunden und Bekannten aus Ost- und Westdeutschland geführt hat, um deren individuelle Erinnerungen an die DDR im Funny-Stil auf Papier zu bringen. Die erste entspringt dabei seinem eigenen Hirn, eingeführt durch ein Splash-Panel, das ihn mit einer Gesprächspartnerin in einem Café sitzend zeigt, die ihn explizit nach seiner eigenen Erinnerung fragt. Während die Farbgebung dieses Panels blass ist, wird der Fokus auf diesen Dialog gelegt, indem dessen Figuren und ihr unmittelbares Umfeld durch kräftige Farben hervorgehoben werden. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil die bunte Vielfalt der Erinnerungen sich im breiten Farbspektrum des Comics widerspiegelt: Jedes Kapitel verfügt über seine eigene Farbwelt. Inhaltlich reichen sie von kindlich-naiv und -rührend fantasievoll oder absurd-komisch über bemerkenswerte kleine Details des großen Ganzen wie unterschiedliche Gerüche oder den regen DDR-Tauschhandel bis hin zur Dialektik bzw. den Dualismus, den man den Menschen aufzwang, zu Nostalgie, Melancholie und Verklärung, zerplatzten Illusionen und Träumen, Tragik, schreiender Ungerechtigkeit und Tod. Doch nicht nur die DDR wird kritisch betrachtet, mitunter auch die Wiedervereinigung bzw. die BRD. Positive und negative Erinnerungen dürften sich in etwa die Waage halten, völlige Gleichgültigkeit ist selten. Es verdichtet sich jedoch ein Bild von einer in der DDR möglichen sorglosen Kindheit und einer von Widersprüchen geprägten Erwachsenenwelt. Fast sämtliche Facetten des Erinnerungsspektrums werden abgedeckt, ohne dass sie bewertet würden. Große Teile wurden aber sehr humoristisch aufbereitet, ihre Erzähler karikiert und hintergründig ironisiert. Der Humor, den Flix hier an Tag legt, ist ebenso herzlich wie erfrischend, doch auch in den tragikomischen bis tieftraurigen Abschnitten trifft er den richtigen Ton und schafft es, den Leser zu berühren. Wie es Flix gelingt, den Leser auf eine solche Achterbahn der Gefühle in dieser Kompaktheit mitzunehmen, ist große Kunst. Damit ist „Da war mal was…“ ein Wende-Comic, der sich stilistisch wie inhaltlich wohltuend von staatlich geförderten Beiträgen zur Erinnerungskultur abhebt und mir den unlängst mit Preisen überhäuften Flix als Zeichner und Autor eindrücklich empfiehlt. Ich möchte mehr von ihm lesen!
„Woran erinnert sich eine Generation, die fast genauso lange in einem geteilten Land gelebt hat wie in einem wiedervereinten?“, fragt der Einband dieser Sammlung der seit 2006 auf den Sonntagsseiten des Berliner Tagesspiegels erschienenen Comicstrip-Reihe des deutschen Zeichners Felix Görmann alias Flix, die 2009 im Carlsen-Verlag erschienen ist und deren dritte erweiterte Auflage, die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Öffnung der Berliner Mauer veröffentlicht wurde, ich mir gekauft habe. Sie umfasst im Hardcover 34 inkl. jeweiligem Titelblatt je vierseitige, meist aus zwölf Panels bestehende „Erinnerungen an hier und drüben“, die auf Interviews basieren, die Flix mit Freunden und Bekannten aus Ost- und Westdeutschland geführt hat, um deren individuelle Erinnerungen an die DDR im Funny-Stil auf Papier zu bringen. Die erste entspringt dabei seinem eigenen Hirn, eingeführt durch ein Splash-Panel, das ihn mit einer Gesprächspartnerin in einem Café sitzend zeigt, die ihn explizit nach seiner eigenen Erinnerung fragt. Während die Farbgebung dieses Panels blass ist, wird der Fokus auf diesen Dialog gelegt, indem dessen Figuren und ihr unmittelbares Umfeld durch kräftige Farben hervorgehoben werden. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil die bunte Vielfalt der Erinnerungen sich im breiten Farbspektrum des Comics widerspiegelt: Jedes Kapitel verfügt über seine eigene Farbwelt. Inhaltlich reichen sie von kindlich-naiv und -rührend fantasievoll oder absurd-komisch über bemerkenswerte kleine Details des großen Ganzen wie unterschiedliche Gerüche oder den regen DDR-Tauschhandel bis hin zur Dialektik bzw. den Dualismus, den man den Menschen aufzwang, zu Nostalgie, Melancholie und Verklärung, zerplatzten Illusionen und Träumen, Tragik, schreiender Ungerechtigkeit und Tod. Doch nicht nur die DDR wird kritisch betrachtet, mitunter auch die Wiedervereinigung bzw. die BRD. Positive und negative Erinnerungen dürften sich in etwa die Waage halten, völlige Gleichgültigkeit ist selten. Es verdichtet sich jedoch ein Bild von einer in der DDR möglichen sorglosen Kindheit und einer von Widersprüchen geprägten Erwachsenenwelt. Fast sämtliche Facetten des Erinnerungsspektrums werden abgedeckt, ohne dass sie bewertet würden. Große Teile wurden aber sehr humoristisch aufbereitet, ihre Erzähler karikiert und hintergründig ironisiert. Der Humor, den Flix hier an Tag legt, ist ebenso herzlich wie erfrischend, doch auch in den tragikomischen bis tieftraurigen Abschnitten trifft er den richtigen Ton und schafft es, den Leser zu berühren. Wie es Flix gelingt, den Leser auf eine solche Achterbahn der Gefühle in dieser Kompaktheit mitzunehmen, ist große Kunst. Damit ist „Da war mal was…“ ein Wende-Comic, der sich stilistisch wie inhaltlich wohltuend von staatlich geförderten Beiträgen zur Erinnerungskultur abhebt und mir den unlängst mit Preisen überhäuften Flix als Zeichner und Autor eindrücklich empfiehlt. Ich möchte mehr von ihm lesen!
 2009, zum 20-jährigen Jubiläum der innerdeutschen Grenzöffnung, erschien Simon Schwartz’ Diplomabschlussarbeit an der HAW Hamburg, der 120 Seiten starke Comicband „drüben!“, im Avant-Verlag. Der 1982 in Erfurt geborene und in Berlin aufgewachsene Schwartz hat sich für sein Buch intensiv mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt und beschreibt, wie und warum seine Eltern einst einen Ausreiseantrag in der DDR stellten, was damit verbunden war und wie sie schließlich zu dritt 1984 in die BRD übersiedeln konnten.
2009, zum 20-jährigen Jubiläum der innerdeutschen Grenzöffnung, erschien Simon Schwartz’ Diplomabschlussarbeit an der HAW Hamburg, der 120 Seiten starke Comicband „drüben!“, im Avant-Verlag. Der 1982 in Erfurt geborene und in Berlin aufgewachsene Schwartz hat sich für sein Buch intensiv mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt und beschreibt, wie und warum seine Eltern einst einen Ausreiseantrag in der DDR stellten, was damit verbunden war und wie sie schließlich zu dritt 1984 in die BRD übersiedeln konnten.
 1978 erschein der bereits vierte Don-Martin-Band innerhalb der Mad-Taschenbuch-Reihe. Wie gehabt wurden rund 160 Schwarzweiß-Seiten mit Martins Comic-Strips gefüllt, wobei sich hier kurze, zum Teil dialogfreie Gags mit einer recht langen „Der Glöckner von Notre Dame“-Parodie, die leider überproportional viel Blocktext enthält, ebenso abwechseln wie mit immer wieder eingestreuten Episoden der Telenovela-Persiflage „Die Feinbein-Saga“, die es auf je ein bis vier Seiten bringen. Gewohnterweise dominieren Martins abgedrehter Zeichenstil, Slapstick mit extra vielen Onomatopoetika (Lautmalereien) und anarchische, schwarzhumorige oder satirische Pointen. Und wie so oft ist man auch mit diesem Büchlein recht schnell durch: Selten schaffen es ganze zwei Panels auf eine Seite, meist wird einem einzelnen großzügigerweise eine ganze Seite zur Verfügung gestellt. Ein somit wieder etwas sehr kurzweiliger, jedoch ungeachtet dessen gelungener Spaß zwischen trashigem Klamauk, Haudrauf-Humor und Hintersinn.
1978 erschein der bereits vierte Don-Martin-Band innerhalb der Mad-Taschenbuch-Reihe. Wie gehabt wurden rund 160 Schwarzweiß-Seiten mit Martins Comic-Strips gefüllt, wobei sich hier kurze, zum Teil dialogfreie Gags mit einer recht langen „Der Glöckner von Notre Dame“-Parodie, die leider überproportional viel Blocktext enthält, ebenso abwechseln wie mit immer wieder eingestreuten Episoden der Telenovela-Persiflage „Die Feinbein-Saga“, die es auf je ein bis vier Seiten bringen. Gewohnterweise dominieren Martins abgedrehter Zeichenstil, Slapstick mit extra vielen Onomatopoetika (Lautmalereien) und anarchische, schwarzhumorige oder satirische Pointen. Und wie so oft ist man auch mit diesem Büchlein recht schnell durch: Selten schaffen es ganze zwei Panels auf eine Seite, meist wird einem einzelnen großzügigerweise eine ganze Seite zur Verfügung gestellt. Ein somit wieder etwas sehr kurzweiliger, jedoch ungeachtet dessen gelungener Spaß zwischen trashigem Klamauk, Haudrauf-Humor und Hintersinn. Wenn man ein Germanistik-Studium begonnen hat und zunächst einmal mit
Wenn man ein Germanistik-Studium begonnen hat und zunächst einmal mit 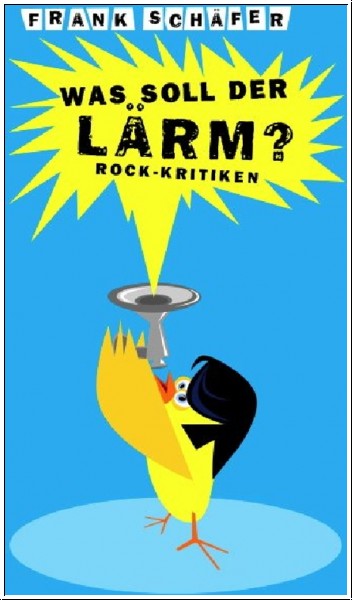 2005, zwischen seiner Anekdoten-Sammlung
2005, zwischen seiner Anekdoten-Sammlung