
ISBN: 3-8927779-07-5
Wie der Vorgänger zum Fernsehjahr 1991 erschien auch das TV-Jahrbuch 1992 in der Hamburger Verlagsgruppe Milchstraße, dem Verlag der renommierten „Cinema“-Zeitschrift und der damals noch jungen „TV Spielfilm“. Das Cover zeigt erstmals keine Action-Helden, sondern Joe Dantes „Gremlins“, und bei den Senderlogos ersetzte man Eins Plus durch den neuen Pay-TV-Sender Premiere. Der Umfang blieb mit rund 200 Seiten identisch.
Im Vorwort des im zweiten Halbjahr 1991 erschienenen Buchs weiß Chefredakteur Willy Loderhose: „Der Boom hält an!“ – und meint damit die hohe Frequenz an Spielfilmen im Fernsehen. Wie bereits ein Jahr zuvor erwähnt er mit dem Sender Premiere das damals noch junge Geschäftsmodell Pay-TV, und er kann voller Stolz verkünden, dass die „TV Spielfilm“ alle zwei Woche über eine Million Exemplare verkauft. Für diese wirbt dann auch erneut das Inhaltsverzeichnis, das eine etwas andere Aufteilung bietet: Der separate Erotikbereich wurde gestrichen.
Bevor es zum Herzstück dieses Bands geht, der Vorschau auf im Fernsehen laufende Spielfilme im Jahre 1992, verschafft TV-Spielfilm-Chefredakteur Christian Hellmann bereits einen groben Überblick und untermauert seine Einschätzung, dass die Anzahl der ausgestrahlten Filme weiter zunähme, mit einer konkreten Zahl: Das Publikum mit Kabelanschluss kann aus wöchentlich über 200 Filmen wählen. Mitverantwortlich ist der erst 1989 gegründete TV-Sender Pro7, der sein Hauptaugenmerk auf Spielfilme legte und seinen Marktanteil auf 8,1 Prozent hatte steigern können. Dass dieses Jahrbuch angesichts einer solchen Zahl keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, versteht sich von selbst.
Wie gehabt lebt der Hauptteil des Buchs von seinen Filmvorstellungen und -kritiken mit schönen großen Bildern. Etwas überraschend ist es, dass man mit „Harry und Sally“ eröffnet, als handele es sich um einen der neuen Höhepunkte schlechthin – dabei war der Film bereits 1991 gelaufen und entsprechend im vorausgegangenen TV-Jahrbuch berücksichtigt worden. Allerdings hat man sich die Mühe gemacht, einen neuen Text zum Film zu verfassen. Unter den „Spielfilmen des Jahres“ finden sich darüber hinaus Titel wie „Stirb langsam II“, „Wie spät ist es?“, „Twins“, „Die letzte Versuchung Christi“ oder auch „Stille Tage in Clichy“ und „Nicht ohne meine Tochter“ sowie natürlich „Gremlins“. Und leider handelt es sich bei den Texten abermals um einen kruden Stilmix aus reinen Vorstellungen, sämtliche Handlung vorwegnehmenden Spoilern und mitunter bissigen Kritiken. Hier wäre eine einheitliche Linie wünschenswert gewesen. Ob einige dieser Texte zuvor bereits 1:1 in der „Cinema“ abgedruckt waren (wie noch in den vorausgegangenen Jahrbüchern der Fall), kann ich nicht beurteilen.
Die einzelnen Bestandteile diverser Filmreihen wie der der Monty-Python- und Romy-Schneider-Filme auf Tele5, der ARD-Sommerthriller oder der William-Powell-, Nick-Nolte-, Robert-Mitchum-, Volker-Schlöndorff und Robert-van-Ackeren-Reihen ebendort werden knapper abgehandelt, gehen dafür aber mit einigen – durchaus kritischen – filmübergreifenden Informationen und Meinungen einher. Besonders interessant dürften die „Schwule Filme“-Reihe auf 3Sat sowie der John-Carpenter-Kanon im ZDF (!) gewesen sein. Weitere Filmausstrahlungen werden nach Sender sortiert in den „Kurz belichtet“-Übersichten angerissen, einige, insbesondere weitere eigentlich interessante Reihen wie Blake Edwards auf Pro7 oder Curd Jürgens sowie polnische ’80er-Filme auf 3Sat finden leider nur noch ohne jegliche Begleitinformation in Listenform statt, und erneut trifft es diesbezüglich Tele5 besonders hart. Schade, denn ich hätte gern gelesen, was das TV-Jahrbuch über Filme wie „Als die Frauen noch Schwänze hatten“, „Bitterer Reis“, „Brennender Tod“, „Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert“ oder „Der große Blonde mit dem blauen Auge“ geschrieben hätte. Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass die Spielfilme der 1980er nach wie vor das TV-Programm beherrschten, wenngleich in Hellmanns Vorwort zu lesen war, dass Abstände zwischen Kino- und Fernsehauswertung immer kürzer würden.
Unter „Service“ werden die übrigen Buchkapitel, die zusammen ein Viertel ausmachen, zusammengefasst. Einleitend schwärmt Redakteur Michael Schrödner von den teuren Produktionen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer 1992 erwarten dürfen: „Der große Bellheim“, die olympischen Sommerspiele, die Fußball-Bundesliga usw. Kurioserweise erwähnt er darunter auch „Marienhof“ (O-Ton: „eine neue ,Lindenstraße’“), empfiehlt abschließend aber dennoch, ab und zu ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Der Serienteil liest sich mit ausführlichen Berichten zu genanntem „Bellheim“ und dem „Marienhof“, Götz George in „Marlock“ (peinlicherweise in der Überschrift (!) „Bartok“ genannt), der Zeichentrickserie „Clever & Smart“ auf Tele5 oder der völlig in Vergessenheit geratenen Pro7-„Traumschiff“-Konkurrenz „Glückliche Reise“ (in der Luft) recht interessant – insbesondere der letzte Artikel „Gottschalk täglich“, mutmaßlich aus der Verlegenheit heraus, eine Late-Night-Show richtig zuordnen zu können, unter „Serien“ einsortiert. Zwei Seiten lang werden die Leserinnen und Leser auf Gottschalks erste tägliche Late-Night-Show auf RTL plus vorbereitet und bekommen das in Deutschland bis dahin weitestgehend unbekannte Konzept erklärt. Das ist wahrlich Fernsehgeschichte.
Das Kapitel „Stars“ porträtiert zeitgenössische beliebte oder auch polarisierende TV-Gesichter wie Hape Kerkeling, Nina Hagen (!), Ulrich Wickert, Kristiane Backer, Hans Hermann Weyer, Martin Lüttge, Lea Rosh, Susanne Holst, good old Rudi Carrell, Marcel Reich-Ranicki und Harald Schmidt (damals noch kein Late-Night-Host, sondern „Nachwuchstalent“). Zugegeben: Ziemlich willkürlich erscheint diese Auswahl schon. Manch bedauerlichen Todesfall ruft das „In Memoriam“-Kapitel ins Gedächtnis, darunter Namen wie Helga Feddersen, Karl-Heinz Köpcke, Klaus Schwarzkopf und Roy Black. Der Sportteil versucht, Golf zum neuen „Quoten-Knüller“ hochzujazzen und widmet sich auf drei Seiten der bevorstehenden Herrenfußball-EM in Schweden aus deutscher Sicht, die bekanntlich einen spektakulären Verlauf nehmen sollte. Eine große Übersicht listet die wichtigsten Sportereignisse des Jahres tabellarisch auf, bevor der beliebte Statistikteil knallharte Zahlen bietet und besonders aus heutiger Sicht damit überrascht, dass Pro7 einen Spielfilmanteil von sage und schreibe 80 % (bei geringem Werbeanteil) aufzuweisen hatte und in der Gunst der Zuschauer die Filmqualität betreffend entsprechend ganz vorne lag. Leider fallen die Statistiken diesmal nicht so ausführlich aus wie zuvor. Adressen und ein Index runden auch diesen Band ab.
Einen Gesamtüberblick über das Spielfilmangebot zu liefern fällt dieser Buchreihe zunehmend schwer, in ihren Versuchen, die gesamte TV-Landschaft zumindest grob zu skizzieren, erscheint dieser Band bruchstückhaft und in seiner Auswahl nicht immer nachvollziehbar. Um das Spielfilmangebot im damaligen TV grob nachvollziehen zu können, ist das Buch dennoch geeignet, wenngleich es ein fähiger Lektor vor Drucklegung leider nie in den Händen gehabt hat. Peinliche Fehler („Stephen Spielberg“) hinterlassen den Eindruck einer lediglich semiprofessionellen Veröffentlichung und verärgern diejenigen Leserinnen und Leser, die sich bei der Verlagsgruppe Milchstraße eigentlich bei Experten wähnten. Offenbar hatte man dort aus der Fehleranfälligkeit der vorherigen Ausgaben aber nichts gelernt. Zu einem letzten Band brachte es diese Reihe noch, dazu später mehr.
 Das 2016 im Hamburger Junius-Verlag erschienene „Schwarze Hamburg-Buch“ der freien Hamburger Journalisten Avantario und Sieg, illustriert von Arbeiten des Hamburger Fotografen Thomas Henning, konzentriert sich auf rund 180 schwarzen Seiten aus mattem Kartonpapier auf die dunklen Seiten der allseits beliebten Hansestadt-Metropole in Deutschlands Norden. Rund 60 ein bis drei Seiten kurze und um ein seitenfüllendes Foto ergänzte Einträge gehen dahin, wo es wehtut – und beschränken sich mitnichten auf das wohl düsterste Kapitel deutscher Geschichte, die NS-Diktatur: Mord und Totschlag, Polizei- und Justizwillkür, Sadismus, Terror, Umweltverbrechen, Sklavenhandel und Dergleichen mehr ziehen sich (auch durch die jüngere) Stadtgeschichte, an vieles erinnere ich mich selbst nur zu gut: Sei es, als der geisteskranke Rechtspopulist Ronald Schill durch die Stimmen von Hamburgerinnen und Hamburgern ins Rathaus gewählt wurde, sei es die Schande des Eppendorfer Universitätsklinikums, als die rassistische Hamburger Polizei den des Drogendealens verdächtigen Achidi John in Komplizenschaft mit einer Medizinerin mit einem Brechmittel zu Tode folterte, oder sei es auch, als Scharlatane der Alster-Klinik das Pornosternchen „Sexy Cora“ alias Carolin Wosnitza mit der x-ten Busenvergrößerung aus Geldgier ins Grab brachten. Andere aufsehenerregende, aber sich vor meiner Zeit zugetragen habenden Fälle wie die abscheulichen Verbrechen Fritz Honkas gehören längst zur Hamburger Folklore, so einiges war mir aber tatsächlich neu oder wurde zumindest noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Klar, eine Millionenmetropole bringt auch viele Sozio- und Psychopathen hervor – und dieses Buch beweist eindrucksvoll, dass sich Hamburg diesbezüglich nicht zu verstecken braucht. Mit seinen Ortsangaben empfiehlt es sich in seinem schnieken matten Einband auch als morbider alternativer Stadtführer, zumal auch stets auf etwaige Mahnmale, Gedenktafeln u.ä. hingewiesen wird. „Das schwarze Hamburg-Buch“ hält die Erinnerung an eine ganze Reihe spektakulärer, widerwärtiger und erschreckender Taten und Ereignisse aufrecht und hat diese zu einer meist gut (statt reißerisch) geschriebenen, präzise pointierten und somit seinen Themen zum Trotz angenehm zu lesenden Sammlung verdichtet, die eine echte Alternative zu den oberflächlichen Hochglanzprodukten der Tourismusindustrie darstellt. Und wäre dieses Buch nur wenige Monate später erschienen, hätte es mit dem völlig irrsinnigen, brutalen Durchboxen des G20-Gipfels durch die damalige versammelte, ebenso größenwahnsinnige wie unzurechnungsfähige Hamburger Faschistoidenschar aus „König“ Olaf Scholz, Hartmut Dudde, Andy (Verbote-)Grote und ihren Handlangern Stoff für mindestens ein weiteres Kapitel gehabt.
Das 2016 im Hamburger Junius-Verlag erschienene „Schwarze Hamburg-Buch“ der freien Hamburger Journalisten Avantario und Sieg, illustriert von Arbeiten des Hamburger Fotografen Thomas Henning, konzentriert sich auf rund 180 schwarzen Seiten aus mattem Kartonpapier auf die dunklen Seiten der allseits beliebten Hansestadt-Metropole in Deutschlands Norden. Rund 60 ein bis drei Seiten kurze und um ein seitenfüllendes Foto ergänzte Einträge gehen dahin, wo es wehtut – und beschränken sich mitnichten auf das wohl düsterste Kapitel deutscher Geschichte, die NS-Diktatur: Mord und Totschlag, Polizei- und Justizwillkür, Sadismus, Terror, Umweltverbrechen, Sklavenhandel und Dergleichen mehr ziehen sich (auch durch die jüngere) Stadtgeschichte, an vieles erinnere ich mich selbst nur zu gut: Sei es, als der geisteskranke Rechtspopulist Ronald Schill durch die Stimmen von Hamburgerinnen und Hamburgern ins Rathaus gewählt wurde, sei es die Schande des Eppendorfer Universitätsklinikums, als die rassistische Hamburger Polizei den des Drogendealens verdächtigen Achidi John in Komplizenschaft mit einer Medizinerin mit einem Brechmittel zu Tode folterte, oder sei es auch, als Scharlatane der Alster-Klinik das Pornosternchen „Sexy Cora“ alias Carolin Wosnitza mit der x-ten Busenvergrößerung aus Geldgier ins Grab brachten. Andere aufsehenerregende, aber sich vor meiner Zeit zugetragen habenden Fälle wie die abscheulichen Verbrechen Fritz Honkas gehören längst zur Hamburger Folklore, so einiges war mir aber tatsächlich neu oder wurde zumindest noch einmal ins Gedächtnis gerufen. Klar, eine Millionenmetropole bringt auch viele Sozio- und Psychopathen hervor – und dieses Buch beweist eindrucksvoll, dass sich Hamburg diesbezüglich nicht zu verstecken braucht. Mit seinen Ortsangaben empfiehlt es sich in seinem schnieken matten Einband auch als morbider alternativer Stadtführer, zumal auch stets auf etwaige Mahnmale, Gedenktafeln u.ä. hingewiesen wird. „Das schwarze Hamburg-Buch“ hält die Erinnerung an eine ganze Reihe spektakulärer, widerwärtiger und erschreckender Taten und Ereignisse aufrecht und hat diese zu einer meist gut (statt reißerisch) geschriebenen, präzise pointierten und somit seinen Themen zum Trotz angenehm zu lesenden Sammlung verdichtet, die eine echte Alternative zu den oberflächlichen Hochglanzprodukten der Tourismusindustrie darstellt. Und wäre dieses Buch nur wenige Monate später erschienen, hätte es mit dem völlig irrsinnigen, brutalen Durchboxen des G20-Gipfels durch die damalige versammelte, ebenso größenwahnsinnige wie unzurechnungsfähige Hamburger Faschistoidenschar aus „König“ Olaf Scholz, Hartmut Dudde, Andy (Verbote-)Grote und ihren Handlangern Stoff für mindestens ein weiteres Kapitel gehabt.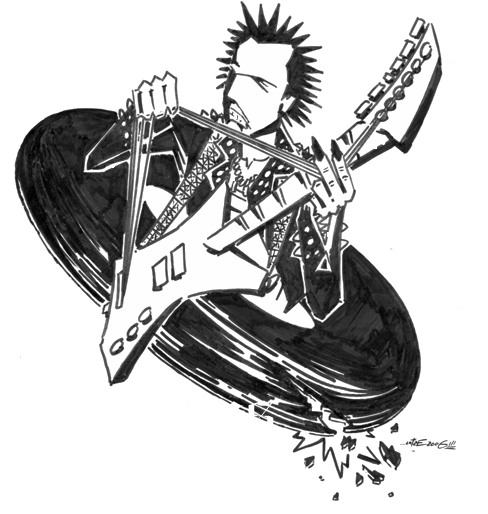
 „Eine kleine Amerikaner…“
„Eine kleine Amerikaner…“ Im Jahre 1980 erschien der vierte „Spion & Spion“-Band innerhalb der deutschen „Mad“-Taschenbuchreihe im Williams-Verlag, der im US-amerikanischen Original bereits 1974 veröffentlicht worden war. Wie gehabt füllen je ein oder zwei Panels die rund 160 unkolorierten, nun wieder nummerierten Seiten, auf ein Vorwort wurde diesmal ebenso verzichtet wie auf die Alliterationen in den Titeln der zwölf Geschichten. Der schwarze und der weiße Spion bekriegen sich erneut ebenso dialogfrei wie erbarmungslos, über ihre Hintergründe erfährt man nichts. Sie repräsentieren das Schwarzweiß-Denken des Kalten Kriegs, das Prohias unter Aussparung jeglicher darüber hinausgehender politischer Kommentare durch den Kakao zieht. So weit, so bekannt. Eine neue Dimension jedoch dürfte die Kreativität und gleichermaßen Absurdität erreicht haben, mit denen sich die beiden Spitznasen gegenseitig Fallen stellen, die stets in verheerenden Explosionen, Unfällen oder Verletzungen münden. Die Unvorhersehbarkeit dieser abstrusen Kettenreaktionen ist es dann auch, die den Spaßfaktor dieses weiteren Spionage-Handbuchs ausmacht, und man kann sich nur wundern, woher Prohias seine aberwitzigen Einfälle nimmt. Die konsequente Reduktion auf dieses Konzept bei gleichzeitig überschäumendem Konstruktionsgeist, um bei stets gleichem Ausgang die im Prinzip immer selbe Geschichte auf vollkommen neue Weise zu erzählen – das ist es, was diese Comics zum Kult machte und einen Eindruck davon vermittelte, auf welch unterschiedliche Weise man sich gegenseitig nach dem Leben trachten kann, wenn es der einzige Inhalt der eigenen Existenz ist. Inspirierend!
Im Jahre 1980 erschien der vierte „Spion & Spion“-Band innerhalb der deutschen „Mad“-Taschenbuchreihe im Williams-Verlag, der im US-amerikanischen Original bereits 1974 veröffentlicht worden war. Wie gehabt füllen je ein oder zwei Panels die rund 160 unkolorierten, nun wieder nummerierten Seiten, auf ein Vorwort wurde diesmal ebenso verzichtet wie auf die Alliterationen in den Titeln der zwölf Geschichten. Der schwarze und der weiße Spion bekriegen sich erneut ebenso dialogfrei wie erbarmungslos, über ihre Hintergründe erfährt man nichts. Sie repräsentieren das Schwarzweiß-Denken des Kalten Kriegs, das Prohias unter Aussparung jeglicher darüber hinausgehender politischer Kommentare durch den Kakao zieht. So weit, so bekannt. Eine neue Dimension jedoch dürfte die Kreativität und gleichermaßen Absurdität erreicht haben, mit denen sich die beiden Spitznasen gegenseitig Fallen stellen, die stets in verheerenden Explosionen, Unfällen oder Verletzungen münden. Die Unvorhersehbarkeit dieser abstrusen Kettenreaktionen ist es dann auch, die den Spaßfaktor dieses weiteren Spionage-Handbuchs ausmacht, und man kann sich nur wundern, woher Prohias seine aberwitzigen Einfälle nimmt. Die konsequente Reduktion auf dieses Konzept bei gleichzeitig überschäumendem Konstruktionsgeist, um bei stets gleichem Ausgang die im Prinzip immer selbe Geschichte auf vollkommen neue Weise zu erzählen – das ist es, was diese Comics zum Kult machte und einen Eindruck davon vermittelte, auf welch unterschiedliche Weise man sich gegenseitig nach dem Leben trachten kann, wenn es der einzige Inhalt der eigenen Existenz ist. Inspirierend!

 Klugscheißerhumor
Klugscheißerhumor „Was ist das Geheimnis einer erfüllenden Beziehung? Begleiten Sie die unglückliche Beziehungswaise Mali dabei, wie sie ihre Antwort auf diese Frage aller Fragen findet. Hilfe erfährt sie dabei von dem erleuchteten Beziehungsweisen Malik, dem einst von Buddha und Jesus die ,Kunst des Herzens’ und das Wissen um den ,siebenstufigen Pfad zu einer erleuchteten Beziehung’ gelehrt wurden.“ (Klappentext)
„Was ist das Geheimnis einer erfüllenden Beziehung? Begleiten Sie die unglückliche Beziehungswaise Mali dabei, wie sie ihre Antwort auf diese Frage aller Fragen findet. Hilfe erfährt sie dabei von dem erleuchteten Beziehungsweisen Malik, dem einst von Buddha und Jesus die ,Kunst des Herzens’ und das Wissen um den ,siebenstufigen Pfad zu einer erleuchteten Beziehung’ gelehrt wurden.“ (Klappentext) Im Jahre 1980, drei Jahre nach seinem Erscheinen in den USA, brachte es dieses Mad-Taschenbuch auch zu einer deutschen Veröffentlichung. Unterteilt in sieben jeweils eine Epoche abbildende Kapitel und eingeleitet von einem dreiseitigen Vorwort wird sich rund 160-Schwarzweißseiten lang von 3050 v. Chr. bis 1969 n. Chr. in alternativer Geschichtsschreibung geübt. Ein kurzer Text leitet in den jeweiligen Abschnitt ein, der sich pro Ereignisjahr in ein großformatiges Bild im Karikaturstil und ein paar Zeilen dazu passenden Text aufteilt, der auf Mad-typische satirische Weise bestimmte Weltereignisse aufs Korn nimmt und gern Parallelen zur Gegenwart zieht oder generell anachronistisch in Erscheinung tritt. So heißt es zum Jahr 31 v. Chr.: „Das Drama zwischen Antonius und Kleopatra findet in der Originalbesetzung statt und ist damit um viele Millionen billiger als die spätere Neuverfilmung mit Richard Burton und Elizabeth Taylor.“ Und 1001: „Leif Eriksson entdeckt Amerika, hält es aber nicht für wert, darüber zu reden.“ Oder 1626: „Die Indianer sind überzeugt, ein glänzendes Geschäft zu machen, indem sie New York den Holländern für 24 Dollar überlassen.“ Auch schön: „1894: Thomas Edison führt den ersten Film vor. Alle sind davon hell begeistert – mit Ausnahme der Filmkritiker.“ Für all die Kriege und sonstigen blutigen Wahnsinn, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht, haben Zeichner Torres und Autor Koch nur Spott übrig, ansonsten mischen sich unter den Humor manch Absurdität, Seitenhiebe und Sprachwitz. Spaßiger Gesichtsunterricht nicht nur für Mad-Jünger und ein stilistisch neuer Ansatz innerhalb der Taschenbuchreihe, die hiermit eine Jubiläumsausgabe feierte, ohne dies mit auch nur einer Silbe zu erwähnen.
Im Jahre 1980, drei Jahre nach seinem Erscheinen in den USA, brachte es dieses Mad-Taschenbuch auch zu einer deutschen Veröffentlichung. Unterteilt in sieben jeweils eine Epoche abbildende Kapitel und eingeleitet von einem dreiseitigen Vorwort wird sich rund 160-Schwarzweißseiten lang von 3050 v. Chr. bis 1969 n. Chr. in alternativer Geschichtsschreibung geübt. Ein kurzer Text leitet in den jeweiligen Abschnitt ein, der sich pro Ereignisjahr in ein großformatiges Bild im Karikaturstil und ein paar Zeilen dazu passenden Text aufteilt, der auf Mad-typische satirische Weise bestimmte Weltereignisse aufs Korn nimmt und gern Parallelen zur Gegenwart zieht oder generell anachronistisch in Erscheinung tritt. So heißt es zum Jahr 31 v. Chr.: „Das Drama zwischen Antonius und Kleopatra findet in der Originalbesetzung statt und ist damit um viele Millionen billiger als die spätere Neuverfilmung mit Richard Burton und Elizabeth Taylor.“ Und 1001: „Leif Eriksson entdeckt Amerika, hält es aber nicht für wert, darüber zu reden.“ Oder 1626: „Die Indianer sind überzeugt, ein glänzendes Geschäft zu machen, indem sie New York den Holländern für 24 Dollar überlassen.“ Auch schön: „1894: Thomas Edison führt den ersten Film vor. Alle sind davon hell begeistert – mit Ausnahme der Filmkritiker.“ Für all die Kriege und sonstigen blutigen Wahnsinn, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht, haben Zeichner Torres und Autor Koch nur Spott übrig, ansonsten mischen sich unter den Humor manch Absurdität, Seitenhiebe und Sprachwitz. Spaßiger Gesichtsunterricht nicht nur für Mad-Jünger und ein stilistisch neuer Ansatz innerhalb der Taschenbuchreihe, die hiermit eine Jubiläumsausgabe feierte, ohne dies mit auch nur einer Silbe zu erwähnen.
 1978 war es so weit: Meine Lieblingsfigur des Mad-Stammzeichners Don Martin, Käpt’n Hirni, feierte sein Debüt im Taschenbuchformat! Die Superhelden-Persiflage um einen in seiner Kindheit und Jugend Superhelden-Comic-süchtigen grenzdebilen, ausschließlich in Soundwords monologisierenden Tunichtgut, der von seinen Eltern, der Schule, dem Arbeitsamt und schließlich seiner Vermieterin herausgeworfen wird, dessen Schicksal aber eine entscheidende Wendung nimmt, als er sich in suizidaler Absicht von einem Hochhausdach stürzt und dabei versehentlich einen Bankräuber zur Strecke bringt, beginnt mit seiner Origin Story und erstreckt sich schließlich über vier wahrhaft heldenhafte Geschichten. So muss er es mit dem infantilen Superschurken Hugo Schlonz alias Babyboy ebenso aufnehmen wie mit einem widerspenstigen Aufzug, mit Gorgonzola, der Monsterspinne und als großes Finale Baldur, dem bösen Bomber. Hierfür hat er wie aus den Mad-Taschenbüchern gewohnt 160 Schwarzweiß-Seiten zur Verfügung, die sich meist auf ein, manchmal zwei Panels beschränken, sodass Don Martins klarer karikierender Strich in den kauzigen, bizarren Zeichnungen optimal zur Geltung kommt. Brutaler Slapstick und anarchischer, respektloser bis absurder Humor geben sich die Klinke in die Hand und verschmelzen zu einer satirischen Parodie klassischer Superhelden-Topoi. Darüber hinaus wird der Film-noir-Stil aufs Korn genommen, wenn Käpt’n Hirni bedeutungsschwanger wie ein Off-Sprecher in kurzen Blocktexten zu seinen Leserinnen und Lesern spricht, jedoch von den dazugehörigen Bildern konterkariert wird, wenn sie die tatsächlichen, wenig rühmlichen Umstände und Ereignisse zeigen. Das „Käpt’n Hirni“-Konzept ist mitsamt seinen Gags ziemlich gut gealtert und ich amüsiere mich nach wie vor köstlich über die Abenteuer des Helden in seiner gepunkteten Unterhose. Käpt’n Hirni for MCU!
1978 war es so weit: Meine Lieblingsfigur des Mad-Stammzeichners Don Martin, Käpt’n Hirni, feierte sein Debüt im Taschenbuchformat! Die Superhelden-Persiflage um einen in seiner Kindheit und Jugend Superhelden-Comic-süchtigen grenzdebilen, ausschließlich in Soundwords monologisierenden Tunichtgut, der von seinen Eltern, der Schule, dem Arbeitsamt und schließlich seiner Vermieterin herausgeworfen wird, dessen Schicksal aber eine entscheidende Wendung nimmt, als er sich in suizidaler Absicht von einem Hochhausdach stürzt und dabei versehentlich einen Bankräuber zur Strecke bringt, beginnt mit seiner Origin Story und erstreckt sich schließlich über vier wahrhaft heldenhafte Geschichten. So muss er es mit dem infantilen Superschurken Hugo Schlonz alias Babyboy ebenso aufnehmen wie mit einem widerspenstigen Aufzug, mit Gorgonzola, der Monsterspinne und als großes Finale Baldur, dem bösen Bomber. Hierfür hat er wie aus den Mad-Taschenbüchern gewohnt 160 Schwarzweiß-Seiten zur Verfügung, die sich meist auf ein, manchmal zwei Panels beschränken, sodass Don Martins klarer karikierender Strich in den kauzigen, bizarren Zeichnungen optimal zur Geltung kommt. Brutaler Slapstick und anarchischer, respektloser bis absurder Humor geben sich die Klinke in die Hand und verschmelzen zu einer satirischen Parodie klassischer Superhelden-Topoi. Darüber hinaus wird der Film-noir-Stil aufs Korn genommen, wenn Käpt’n Hirni bedeutungsschwanger wie ein Off-Sprecher in kurzen Blocktexten zu seinen Leserinnen und Lesern spricht, jedoch von den dazugehörigen Bildern konterkariert wird, wenn sie die tatsächlichen, wenig rühmlichen Umstände und Ereignisse zeigen. Das „Käpt’n Hirni“-Konzept ist mitsamt seinen Gags ziemlich gut gealtert und ich amüsiere mich nach wie vor köstlich über die Abenteuer des Helden in seiner gepunkteten Unterhose. Käpt’n Hirni for MCU!