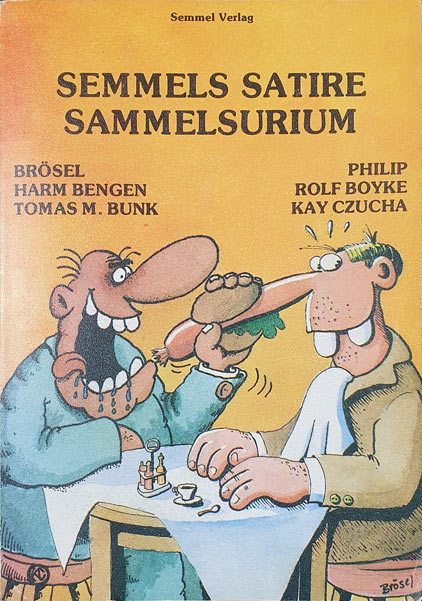Meine Oma las für ihr Leben gern Krimis. Also schenkte ich ihr irgendwann als Kind, es müsste 1990 oder Anfang der 1990er gewesen sein, diesen rund 400-seitigen Taschenbuch-Schmöker aus dem damals renommierten Scherz-Verlag (der sich entgegen seinem Namen nicht etwa auf humoristische, sondern auf Kriminalliteratur spezialisiert und zahlreiche britische Krimis nach Deutschland gebracht hatte) aus dem Jahre 1990 zu Weihnachten. Das hatte sich aufgrund des Titels und der, wie ich finde, recht hübschen Aufmachung angeboten, zumal konnte ich ihn mir für die 9,80 DM, die der Verlag aufgerufen hatte, von meinem Taschengeld leisten. Etliche Jahre nach ihrem Tod kam das Buch – zusammen mit zahlreichen anderen – zu mir zurück. Ihm ist anzusehen, dass sie es gelesen hat, und im vergangenen Winter tat ich es ihr um die Weihnachtszeit herum gleich.
Meine Oma las für ihr Leben gern Krimis. Also schenkte ich ihr irgendwann als Kind, es müsste 1990 oder Anfang der 1990er gewesen sein, diesen rund 400-seitigen Taschenbuch-Schmöker aus dem damals renommierten Scherz-Verlag (der sich entgegen seinem Namen nicht etwa auf humoristische, sondern auf Kriminalliteratur spezialisiert und zahlreiche britische Krimis nach Deutschland gebracht hatte) aus dem Jahre 1990 zu Weihnachten. Das hatte sich aufgrund des Titels und der, wie ich finde, recht hübschen Aufmachung angeboten, zumal konnte ich ihn mir für die 9,80 DM, die der Verlag aufgerufen hatte, von meinem Taschengeld leisten. Etliche Jahre nach ihrem Tod kam das Buch – zusammen mit zahlreichen anderen – zu mir zurück. Ihm ist anzusehen, dass sie es gelesen hat, und im vergangenen Winter tat ich es ihr um die Weihnachtszeit herum gleich.
Fast wie ein Adventskalender bringt es diese Zusammenstellung auf 20 Geschichten verschiedener Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Länge, ausgewählt von Gisela Eichhorn:
Patricia Highsmith – Variationen über ein Thema
Spannend und unvorhersehbar geschriebene Dreiecksgeschichte um eine herrliche irre Femme fatale mit fieser Pointe.
Agatha Christie – Vierundzwanzig Schwarzdrosseln
Hercule Poirot erkennt als Einziger einen Mord im Tode eines Sonderlings. Typischer Christie-Stoff – und es geht viel ums Essen.
Roald Dahl – Lammkeule
Eine Frau erschlägt ihren Mann mit einer gefrorenen Lammkeule und verfüttert das Mordwerkzeug anschließend in zubereiteter Form an die Ermittler. Bezieht seine Spannung daraus, was ihr Motiv war – der Mann hat ihr irgendetwas eröffnet, aber man weiß nicht, was. Dies wird aber leider nicht aufgelöst.
Charlotte Armstrong – Kein gewöhnlicher Montag
Breitet recht langatmig anlässlich des Todes eines wehleidigen alten Muttchens ein kompliziertes Familiengeflecht aus, innerhalb dessen die Protagonistin sich auf der Spur einer Verschwörung wähnt.
Bill Pronzini – Das Netz
Auftragsgangster rennt seinem Geld hinterher und kommt dabei einem Mörder auf die Schliche. Gelungen.
Romain Gary – Ein Humanist
Bitterböse und zynisch, zugleich Ehrerbietung an die großen Klassiker der Literatur und Abgesang auf den Humanismus während des Zweiten Weltkriegs.
Ron Goulart – Der Sarg wartet schon
Hübsch makabre Geschichte auf „Geschichten aus der Gruft“-Niveau um fanatische Sammler von Horrorfilm-Devotionalien.
Margaret Millar – McGownyes Wunder
Weist einen etwas poetischeren Stil als die bisherigen Geschichten auf und weiß zu gefallen. Eine erneut makabre Geschichte über eine fehlende Leiche, eine dann doch nicht Tote und eine schräge Liebe mit mehrdeutig interpretierbarem Ende.
Peter Lovesey – Ein vermögender Mann
Lovesey schreibt böse moralisch/moritatisch über Ahnenforschung und Betrugsversuche – mit offenem Ausgang, den man sich aber denken kann.
Stephen Wasylyk – Immer Ärger mit Walter
Schwarzhumorige Moritat über den Mordversuch an einem nervigen Nassauer aus der eigenen Verwandtschaft.
Dorothy Salisbury Davis – Bis daß der Tod uns scheide…
…spielt im Schriftsteller-Business und hat in der deutschen Übersetzung leider ein schlechtes Korrektorat erfahren: Zeichensetzung, Grammatik, Tippfehler wie „Anwald“, „kittis“, „überlasseln“ – das ist umso ärgerlicher, als es in der Geschichte u.a. um überarbeitungswürdige Manuskripte geht. Diese dreht sich um eine toxische Ehe und einen Mord, von dem man zwischenzeitlich glauben gemacht wird, der Ehemann wolle ihn begehen, es dann aber doch anders kommt, und ist langatmig sowie kompliziert konstruiert. Generell finden sich in diesem Buch ein paar holprige Übersetzungen aus dem englischen Original (statt „entgegnete“ heißt es bspw. ständig „versetzte“) sowie der eine oder andere orthographische Fehler.
Edward D. Hoch – Vor die Hunde gegangen
Hoch gewährt Einblicke ins Hunderennen-Wettmilieu, sehr klassisch britisch.
Jack Ritchie – Herzlich willkommen im Kittchen
Zynische Story um einen korrupten Gefängnischef – grandios!
Jonathan Craig – Nenn mich Nick
Hier geht es schwarzhumorig nach dem Motto „Hell ain‘t a bad place to be“ zu, erhält nach einem Mord und einer Wendung aber leider doch noch eine ganz andere Tendenz.
Pauline C. Smith – Russisches Roulette
Ein aus Sicht des ermittelnden Polizisten geschilderter Fall eines ebenso bizarren wie perfiden Selbstmords, bei dem ein etwas einfältiger Arbeiter benutzt wurde, damit der Selbstmörder sich an ihm rächen kann.
Ursula Curtiss – Schneeball
Curtiss fügt die Vorgänge um ein Verlegerehepaar, das sich hasste, eine einsame Blockhütte im Schnee, einen vermuteten Mord, eine Katze und eine Leiche, die erst ganz am Schluss gefunden wird, zu einer unterhaltsamen Kriminalschnurre zusammen.
Joyce Harrington – Vogelperspektiven
Eigenartiger, aber spannend erzählter Psycho-Thriller um zwei Freundinnen und einen Künstler mit Vogelmanie, der Frage danach, wer in seinen Ausführungen Recht hat, und einer leider schwachen, mysteriösen Pointe, die sich mir nicht ganz erschlossenen hat.
Robert L. Fish – Mondscheingärtner
Kleinstädtisch und schwarzhumorig schreibt Fish von einer verschwundenen Ehefrau und wartet mit einer überraschenden Pointe auf, die sich aus der Lektüre aber kaum erklären oder ableiten lässt… oder?
Lawrence Block – Paß in Ordnung
Ein Pärchen versucht den perfekten Mord. Was sich zunächst wie eine Bonnie-und-Clyde-Romanze liest, entpuppt sich nach einer Wendung als zynisches, abgekartetes Spiel.
Gerald Tomlinson – Reingelegt
Launiges Schelmenstück über einen frustrierten Schreiber, der die Öffentlichkeitsarbeit an einem College mit rekordverdächtig schlechter Football-Mannschaft betreibt und kurzerhand ein anderes, wesentlich erfolgreicheres Provinzteam eines fiktiven Provinzcolleges erfindet.
Hat alles in allem Spaß gemacht, denn auf eine schwächere Geschichte folgt meist wieder eine stärkere, die die vorausgegangene vergessen lässt, und der Leseeifer wird mit der einen oder anderen Perle belohnt. Zudem bietet diese Sammlung einen netten Überblick über das Genre im Kurzformat.
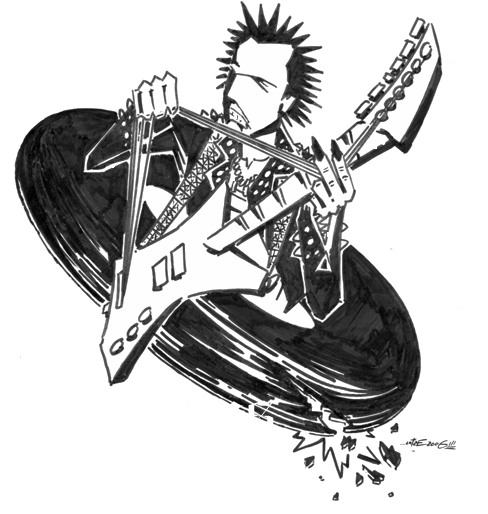

 Der Cinema-Verlag machte mit seinen fragwürdigen „Sex im Kino“-Jahrbüchern noch eine ganze Weile weiter. Nach den Bänden über die Jahre
Der Cinema-Verlag machte mit seinen fragwürdigen „Sex im Kino“-Jahrbüchern noch eine ganze Weile weiter. Nach den Bänden über die Jahre  Es musste ja so kommen: Nachdem „Mad“-Stamm- und Kultzeichner Don Martin bereits die Taschenbuchreihe hatte eröffnen dürfen, schnappte er über, als man ihm sagte, dass auch die Nummer 4 wieder ihm ganz allein gewidmet sein würde. Im US-amerikanischen Original erschien diese im Jahre 1974, ein Jahr später stand die deutsche Fassung in den Regalen der Hochliteratur. 160 unnummerierte Schwarzweiß-Seiten strapazieren das Zwerchfell, für die Dick de Bartolo Don Martin bei den Texten unterstützte.
Es musste ja so kommen: Nachdem „Mad“-Stamm- und Kultzeichner Don Martin bereits die Taschenbuchreihe hatte eröffnen dürfen, schnappte er über, als man ihm sagte, dass auch die Nummer 4 wieder ihm ganz allein gewidmet sein würde. Im US-amerikanischen Original erschien diese im Jahre 1974, ein Jahr später stand die deutsche Fassung in den Regalen der Hochliteratur. 160 unnummerierte Schwarzweiß-Seiten strapazieren das Zwerchfell, für die Dick de Bartolo Don Martin bei den Texten unterstützte.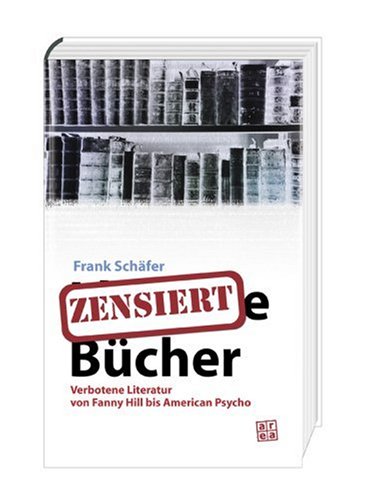 Zu meinen favorisierten zeitgenössischen deutschen Autoren sowohl im Sachbuchbereich als auch in der Belletristik zählt der Braunschweiger Literatur- und Musikexperte Frank Schäfer, ohne dessen im Jahre 2007 im Erftstädter Area-Verlag erschienener, rund 400-seitiger Abhandlung über von der Zensur betroffene Bücher ich nicht mehr auszukommen beschloss und sie mir neben
Zu meinen favorisierten zeitgenössischen deutschen Autoren sowohl im Sachbuchbereich als auch in der Belletristik zählt der Braunschweiger Literatur- und Musikexperte Frank Schäfer, ohne dessen im Jahre 2007 im Erftstädter Area-Verlag erschienener, rund 400-seitiger Abhandlung über von der Zensur betroffene Bücher ich nicht mehr auszukommen beschloss und sie mir neben