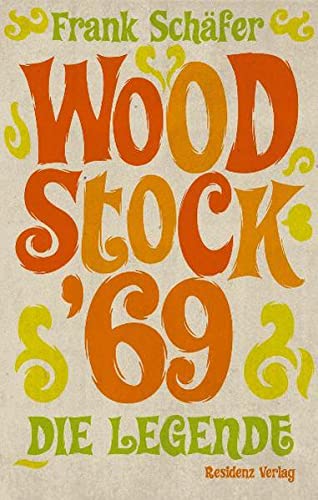 Der Braunschweiger Frank Schäfer, Autor zahlreicher Veröffentlichungen aus den Bereichen Literatur- und Musikkritik, Populär- und Subkultur sowie autobiographisch geprägter Romane, machte sich mit dem im Jahre 2009 im österreichischen Residenz-Verlag veröffentlichten „Woodstock ‘69“ daran, ein ganz dickes Brett zu bohren: eine sich über rund 200 Taschenbuchseiten erstreckende Rekonstruktion des legendären Hippiefestivals, die sich auf eine beachtliche Zahl an Quellen stützt. Natürlich war der 1966 geborene Schäfer seinerzeit nicht selbst vor Ort. Dank seiner akribischen Quellenauswertung liest sich das in fünf Hauptkapitel unterteilte Buch jedoch mitunter, als sei er es gewesen.
Der Braunschweiger Frank Schäfer, Autor zahlreicher Veröffentlichungen aus den Bereichen Literatur- und Musikkritik, Populär- und Subkultur sowie autobiographisch geprägter Romane, machte sich mit dem im Jahre 2009 im österreichischen Residenz-Verlag veröffentlichten „Woodstock ‘69“ daran, ein ganz dickes Brett zu bohren: eine sich über rund 200 Taschenbuchseiten erstreckende Rekonstruktion des legendären Hippiefestivals, die sich auf eine beachtliche Zahl an Quellen stützt. Natürlich war der 1966 geborene Schäfer seinerzeit nicht selbst vor Ort. Dank seiner akribischen Quellenauswertung liest sich das in fünf Hauptkapitel unterteilte Buch jedoch mitunter, als sei er es gewesen.
So lassen sich die Vorbereitungen von der Gründung der Veranstaltungsfirma mit ihren gegensätzlichen Charakteren über fragwürdige Finanzdeals inkl. deren Hintergründe bis zu den Schwierigkeiten, ein passendes Gelände zu finden, nachlesen. Dass das Festival letztlich gar nicht in Woodstock, sondern 50 Kilometer entfernt stattfand, dürfte bereits für viele nicht unbedingt zum Allgemeinwissen zählen. Man erfährt Details zur Zusammenstellung des Line-Ups, sogar die einzelnen Gagen werden genannt. Schäfer schreibt unterhaltsam und bei aller Faktentreue spannend. Kritische Worte in Richtung der Veranstalter und deren Organisationsschwächen lassen früh erahnen, dass Schäfer nicht daran gelegen ist, den Woodstock-Mythos weiter zu nähren. Stattdessen stellt er diesen infrage, setzt sich aber auch mit von anderen kolportierter Kritik auseinander und zitiert zahlreiche Zeitzeugen. Über Schein und Wirklichkeit der u. a. von Warner Brothers finanziell gepuderten Veranstaltung heißt es beispielsweise auf S. 39:
„[…] [D]as öffentliche Bild war – und ist bis heute – ein anderes: nämlich das eines finanziellen Fiaskos. Und die Verantwortlichen taten gut daran, dieses Bild aufrechtzuerhalten, denn es verschaffte allen ein Alibi. Man konnte sich hier amüsieren, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, den Ausverkauf der Hippie-Lehre zu unterstützen. ‚Erst das‘, konstatiert Thomas Groß zu Recht, ‚machte aus dem Ereignis eine Art Lourdes des gegenkulturellen Glaubens.‘“
Einen Großteil des Buchs machen detaillierte Beschreibungen der einzelnen Auftritte aus, die weit über das hinausgehen, was man in den bekannten Dokumentarfilmen zu sehen und hören bekommt. Schäfer liefert Hintergrundinformationen, Analysen und Stimmen. Er geht auf die gesellschaftlichen und politischen Umstände angesichts des Vietnamkriegs sowie die Gründe für die Reihenfolge, in der die verschiedenen Acts die Bühne betraten, ein und zitiert ganze Songtextpassagen, stets begleitet vom Stimmungsbild der öffentlichen Berichterstattung und Beschreibungen der immer schlechter werdenden infrastrukturellen Umstände vor Ort – und wie man ihnen begegnete. CANNED HEAT und MOUNTAIN als musikalisch etwas härtere Bands sind ebenso Teil Schäfers musikhistorischer Reflektion wie THE GRATEFUL DEAD, wenn er der Frage nachgeht, weshalb ausgerechnet diese Vorzeigehippies trotz ihres Auftritts so wenig mit Woodstock in Verbindung gebracht werden. Mit CCR und THE WHO betraten wirklich gute Bands die Woodstock-Bühne, von denen mindestens letztere gar nicht so recht aufs Festival passten – wie Schäfer treffend analysiert.
Unterbrochen wird der musikalische Teil von einem Exkurs zu LSD-Papst Timothy Leary – frei von Verklärung, vielmehr fundiert und angemessen kritische Stimmen zitierend – sowie etwas, das sich bereits immer mehr angedeutet hatte: einem vielleicht recht hart anmutenden, aber gerechten Abgesang auf den Woodstock-Mythos und die Hippies, wofür Schäfer das „Westcoast-Woodstock“ Altamont Free Concert und die bereits zuvor verübten Morde durch die „Manson-Family“ heranzieht. Er zitiert verschiedene Erklärungsversuche und -ansätze und fasst die Ausschreitungen auf etlichen Festivals nach Woodstock zusammen. Anschließend geht es zurück nach Woodstock und damit zu den Sonntagsauftritten, wie jenem von CROSBY, STILL, NASH & YOUNG kurz vor der Veröffentlichung des ersten Soloalbums Neil Youngs, dem der Rock’n’Roll-Covertruppe SHA NA NA und natürlich Headliner JIMI HENDRIX‘, der – wie seine Vorgänger – erst am Montagmorgen spielte, als der Großteil des Publikums bereits wieder abgereist war! Seine Berichte zu den nicht in den bekannten Dokumentar- und Konzertfilmen enthaltenen Auftritten fußt Schäfer auf etlichen anderen Quellen bis hin zu Bootleg-Aufnahmen, aus denen er sie gewissermaßen rekonstruiert. Meist macht er zudem Angaben zum jeweiligen Bild- und/oder Ton-Veröffentlichungsstatus der einzelnen Auftritte, auch hier bis hin zu Bootlegs und YouTube-Fragmenten, was Woodstock-Archäolog(inn)en und -Sammler(innen) erfreuen dürfte (heute, also 14 Jahre später, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell ist).
Teil des Woodstock-Mythos ist jener um JIMI HENDRIX, und auch dieser hat bei Schäfer kaum Bestand. Hendrix habe den US-Krieg gegen Vietnam sogar befürwortet und die Nationalhymne schon lange im Programm gehabt. (Schäfers Bibliographie weist übrigens zwei gesonderte Veröffentlichungen zu Hendrix auf: „A Tribute To Jimi Hendrix“, 2002 und „Being Jimi Hendrix“, 2012.) Das letzte Kapitel widmet sich der Postfestival-Rezeption und beginnt mit einer Art Pressespiegel. Außerdem wird die sicherlich nicht ganz unbedeutende Rolle der Filmcrew einzuordnen versucht. Schäfers These, und sie wird wahr sein: Der überraschend friedliche Ablauf beruht vor allem darauf, dass die Polizei draußen bleiben musste und der Sicherheitsdient sich aus eigenen, quasi subkulturellen Reihen rekrutierte – in Kombination mit einem drogensedierten Publikum. Dass Veranstalter, Publikums, Einzelinterpreten und Bands aber ein verschworener, für Love & Peace an einem Strang ziehender Haufen gewesen seien, gehört aber ins Reich der Fabel. Schlussendlich zieht er ein sich aus zahlreichen Zitaten zusammensetzendes Fazit zur Entstehung des Woodstock-Mythos, den er mit seinem Buch beeindruckend auseinandergenommen hat.
Insgesamt setzt Schäfer 240 Quellenverweise; wiederholt geht er auch über die Zitatform hinaus auf andere Literatur zum Thema sowie Szenen der Woodstock-Filme ein. Er zitiert auch sich widersprechende Aussagen und versucht, durch Abwägungen der Wahrheit näherzukommen. Für diese Kleinarbeit gebührt ihm ebenso Respekt wie für sein Geschick, daraus eine spannende Lektüre zu formen, die sich flüssig liest. Außer in jenen Momenten, in denen Schäfer seiner Schwächen für die Verwendung möglichst obskurer Wörter nachgibt. Gestolpert bin ich u.a. über lysergsauer (S. 27, = unter LSD-Einfluss), bramarbasiert (S. 76, = prahlerisch), Inaugurationsakt (ebd., = Amtseinführungsakt), Locus amoenus (S. 140, = idealisierende Naturschilderung in der Literatur), bukolisch (S. 141, = idyllisch), ausbedungen (S. 165, = zur Bedingung gemacht), decrouvierenden (S. 170, = entlarvenden) und arrondierend (S. 181, = abrundend).
Ein paar Fotos wären indes schön gewesen, insbesondere dann, wenn Schäfer Bilder wie z. B. die Plakatgestaltungen beschreibt. Die Buchmitte offeriert zumindest ein wenig Vor-Ort-Bildmaterial in Schwarzweiß. Sei’s drum, „Woodstock ‘69“ brachte mir als grundsätzlich pop- und rockkulturell interessiertem Leser, der jedoch Hippies und ihre Musik verabscheut, nicht nur den Festivalverlauf, sondern generell US-Musik der 1960er näher, wobei Schäfers subjektiver Musikgeschmack natürlich in seine Bewertungen miteinfloss. Interessanterweise schreibt er im Zusammenhang mit SHA NA NA vom Musicalfilm „Grease“ als das Ende eines ersten ‘50er-Revivals, das bereits Ende der 1960er begonnen habe – gewissermaßen also auch durch den SHA-NA-NA-Gig auf der Woodstock-Bühne.
Als überraschend hart empfand ich lediglich Schäfers JOAN-BAEZ-Schelte. Frank, wir wissen doch beide: Ohne Baez kein „Diamonds and Rust“ von JUDAS PRIEST!
 Im Jahre 1974 veröffentlichte der Melzer-Verlag innerhalb seiner „Brumm Comix“-Reihe die erste und bis dato anscheinend einzige deutsche Übersetzung der „Pogo“-Comicstrips Walt Kellys, die der US-Amerikaner von den 1940ern bis in die 1970er hinein vorrangig für eine Vielzahl von Tageszeitungen anfertigte. Der Band im Taschenbuch/Softcover-Album-Zwischenformat muss leider ohne Seitenzahlen auskommen, dürfte aber auf um die 100 bis zu sechs Panels umfassende Schwarzweißseiten kommen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind hier 14 Geschichten abgedruckt.
Im Jahre 1974 veröffentlichte der Melzer-Verlag innerhalb seiner „Brumm Comix“-Reihe die erste und bis dato anscheinend einzige deutsche Übersetzung der „Pogo“-Comicstrips Walt Kellys, die der US-Amerikaner von den 1940ern bis in die 1970er hinein vorrangig für eine Vielzahl von Tageszeitungen anfertigte. Der Band im Taschenbuch/Softcover-Album-Zwischenformat muss leider ohne Seitenzahlen auskommen, dürfte aber auf um die 100 bis zu sechs Panels umfassende Schwarzweißseiten kommen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind hier 14 Geschichten abgedruckt.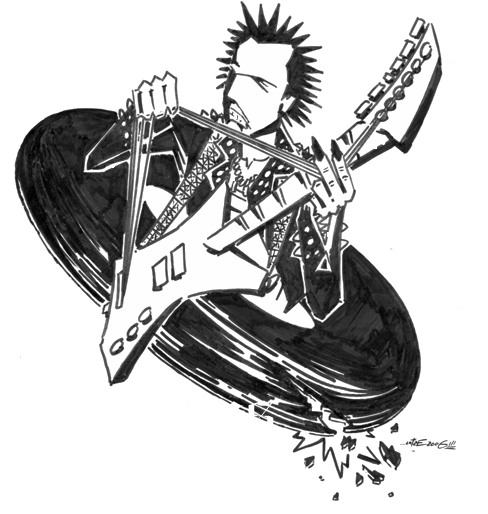
 Von alten Sexklamotten, wie sie hierzulande nach der sexuellen Revolution ab Ende der 1960er produziert wurden, geht auf manch Filmfreund eine seltsame Faszination aus, wovon auch ich mich nicht freisprechen kann – illustrieren sie doch nicht zuletzt die Entwicklung des Umgangs mit Themen wie Erotik und Sexualität auf der Leinwand und sind sie nicht selten entlarvende Zeitdokumente. Die ab 1978 produzierte, diegetisch Ende der 1950er angesiedelte deutsch-israelische „Eis am Stiel“-Reihe vermengte Coming-of-Age-Elemente mit Sex und Humor in unterschiedlicher Gewichtung und Qualität, wobei es sich zumindest bei den ersten beiden Teilen um tatsächlich gute Filme handelt. Ausgemachter Fan dieser Reihe ist der Düsseldorfer Schauspieler und Autor Martin Hentschel, der bereits zur Commedia sexy all’italiana sowie zur „Kumpel“-Reihe publiziert hatte und im Jahre 2016 – wie gewohnt im Eigenverlag – dieses rund 380-seitige Taschenbuch zum Thema veröffentlichte.
Von alten Sexklamotten, wie sie hierzulande nach der sexuellen Revolution ab Ende der 1960er produziert wurden, geht auf manch Filmfreund eine seltsame Faszination aus, wovon auch ich mich nicht freisprechen kann – illustrieren sie doch nicht zuletzt die Entwicklung des Umgangs mit Themen wie Erotik und Sexualität auf der Leinwand und sind sie nicht selten entlarvende Zeitdokumente. Die ab 1978 produzierte, diegetisch Ende der 1950er angesiedelte deutsch-israelische „Eis am Stiel“-Reihe vermengte Coming-of-Age-Elemente mit Sex und Humor in unterschiedlicher Gewichtung und Qualität, wobei es sich zumindest bei den ersten beiden Teilen um tatsächlich gute Filme handelt. Ausgemachter Fan dieser Reihe ist der Düsseldorfer Schauspieler und Autor Martin Hentschel, der bereits zur Commedia sexy all’italiana sowie zur „Kumpel“-Reihe publiziert hatte und im Jahre 2016 – wie gewohnt im Eigenverlag – dieses rund 380-seitige Taschenbuch zum Thema veröffentlichte.


















 Es wurde wirklich mal Zeit, mich mit den Erzeugnissen des deutschen Weissblech-Comics-Verlags zu beschäftigen. Dieser gründete sich, zunächst als Hobby-Projekt, in den 1990ern und lehnte sich hommagenartig an den US-amerikanischen Kultverlag „EC“ an – entsprechend kürzt er sich „WC“ ab… Und dort würde manch Sittenwächter(in) sicherlich auch gern dessen Heftchen hinunterspülen, allen voran vermutlich solche, wie sie in diesem, sich an eine
Es wurde wirklich mal Zeit, mich mit den Erzeugnissen des deutschen Weissblech-Comics-Verlags zu beschäftigen. Dieser gründete sich, zunächst als Hobby-Projekt, in den 1990ern und lehnte sich hommagenartig an den US-amerikanischen Kultverlag „EC“ an – entsprechend kürzt er sich „WC“ ab… Und dort würde manch Sittenwächter(in) sicherlich auch gern dessen Heftchen hinunterspülen, allen voran vermutlich solche, wie sie in diesem, sich an eine 


















 Als ich dieses rund 200-seitige Softcover-Album aus der Carlsen-Qualitätscomicschmiede in einer Wühlkiste auf der Comic- und Manga-Convention in der Hamburger Fabrik entdeckte, fühlte ich mich wohlig an meine Kindheit erinnert, als ich mich immer freute, ein extradickes Ferien-Comicsonderheft auf dem Flohmarkt zu finden und es genüsslich während des Sommers zu verschlingen. Also sackte ich den im Mai 1996 veröffentlichten, vollfarbigen, auf mattem Qualitätspapier gedruckten Wälzer ein und vergrub mich auf meinem Urlaubsflug nach Mallorca darin.
Als ich dieses rund 200-seitige Softcover-Album aus der Carlsen-Qualitätscomicschmiede in einer Wühlkiste auf der Comic- und Manga-Convention in der Hamburger Fabrik entdeckte, fühlte ich mich wohlig an meine Kindheit erinnert, als ich mich immer freute, ein extradickes Ferien-Comicsonderheft auf dem Flohmarkt zu finden und es genüsslich während des Sommers zu verschlingen. Also sackte ich den im Mai 1996 veröffentlichten, vollfarbigen, auf mattem Qualitätspapier gedruckten Wälzer ein und vergrub mich auf meinem Urlaubsflug nach Mallorca darin.

















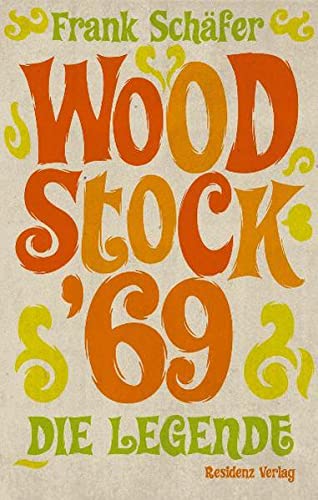 Der Braunschweiger Frank Schäfer, Autor zahlreicher Veröffentlichungen aus den Bereichen Literatur- und Musikkritik, Populär- und Subkultur sowie autobiographisch geprägter Romane, machte sich mit dem im Jahre 2009 im österreichischen Residenz-Verlag veröffentlichten „Woodstock ‘69“ daran, ein ganz dickes Brett zu bohren: eine sich über rund 200 Taschenbuchseiten erstreckende Rekonstruktion des legendären Hippiefestivals, die sich auf eine beachtliche Zahl an Quellen stützt. Natürlich war der 1966 geborene Schäfer seinerzeit nicht selbst vor Ort. Dank seiner akribischen Quellenauswertung liest sich das in fünf Hauptkapitel unterteilte Buch jedoch mitunter, als sei er es gewesen.
Der Braunschweiger Frank Schäfer, Autor zahlreicher Veröffentlichungen aus den Bereichen Literatur- und Musikkritik, Populär- und Subkultur sowie autobiographisch geprägter Romane, machte sich mit dem im Jahre 2009 im österreichischen Residenz-Verlag veröffentlichten „Woodstock ‘69“ daran, ein ganz dickes Brett zu bohren: eine sich über rund 200 Taschenbuchseiten erstreckende Rekonstruktion des legendären Hippiefestivals, die sich auf eine beachtliche Zahl an Quellen stützt. Natürlich war der 1966 geborene Schäfer seinerzeit nicht selbst vor Ort. Dank seiner akribischen Quellenauswertung liest sich das in fünf Hauptkapitel unterteilte Buch jedoch mitunter, als sei er es gewesen.














